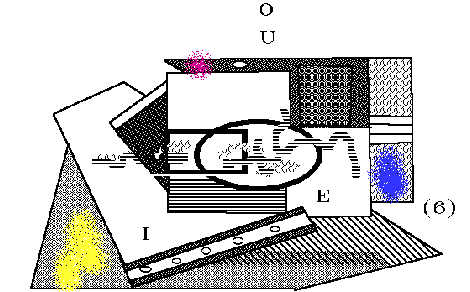
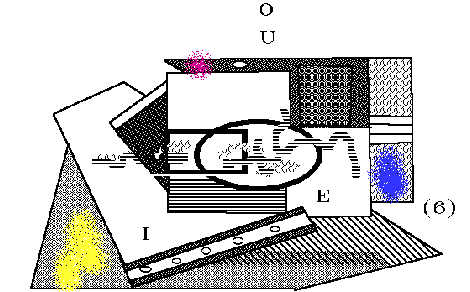
Erwera Glaut
In diesem Aufsatz wird stufenweise sichtbar gemacht, dass Interkulturelle Philosophie im Umgang mit dem Anderen und sich selbst auf eine Reihe viel zu wenig beachteter Schwierigkeiten trifft. Die bisherigen Ansätze bedürfen daher einer weiteren pragmatischen Vertiefung und philosophischen Überarbeitung.
"How
can we study other cultures and peoples from a libertarian
or non-repressive and non-manipulative
perspective?"
(Said)
Wir besitzen
eigentlich, genau genommen, keine Begriffe, die so "neutral" wären, dass sie für
die Beschreibung aller Sozialgefüge, von der EU bis zu einem Eingeborenenstamm
am Amazonas, für die evolutionslogischen Positionen, die Bewertung der
religiösen, kulturellen, politischen, sozialen oder sprachlichen Gegebenheiten
angemessen wären. Wir haben alle irgendwie durch die Gesellschaft, in der wir
leben, gefärbte Brillen mit einem bestimmten Schliff und sehen Menschen und
Systeme einer anderen Färbung nur durch die Färbung und den Schliff unserer
Brillen. Wir nähern uns dem Problem stufenweise.
Beschreibungen sozialer Systeme folgen selbst im
Wissenschaftsbetrieb einer Evolutionslogik im Sinne der oben dargestellten
Evolutionsgesetze. Die Einzelwissenschaft im Stadium 1 in der Autorität anderer
Faktoren gebunden (II. HLA, 1), befreit sich aus der Autorität dieser anderen
gesellschaftlicher Faktoren (z. B. der Religion) und erarbeitet sich ihre
Selbständigkeit. Im nächsten Schritt erreicht sie in sich innere
Differenzierung, wobei die einzelnen Unterschulen mit ihren partikularen
Positionen sich bekämpfen und ausschließen (II. HLA, 2). Im nächsten Stadium
bilden sich integrative Ansätze, welche Unterschulen miteinander
verbinden (II. HLA, 3), was aber immer noch zu unbefriedigenden Ergebnissen
führt. Im letzten Schritt könnten sich die Schulen in der (Or-Om)-Wissenschaft
erneuern und synthetisieren sowie mit allen anderen Wissenschaften
vereinen.
Unser folgender Ansatz zur Beschreibung eines Nationalstaates des Zentrums gehört wohl am ehesten in die Phase II. HLA, 3. Funktionalistische und konflikttheoretisch-dialektische (marxistische) und postmoderne Positionen ergeben etwa das folgende Faktorenmodell des Staates, welches nur für hochindustrialisierte Länder Anwendung finden kann und selbst einem bestimmten Punkte der Wissenschaftsentwicklung entspricht. In diesem System "gehen die Uhren nach einem bestimmten, durch die Komplexität und die vielfältigen Abstimmungsprozesse geprägten internen Rhythmus und folgen bestimmten Funktionalgesetzen". In anderen Systemen "gehen die Uhren völlig anders".
Das Modell
der umseitigen Figur 2 ist gleichsam eine Synthese aller in der Gesellschaft
selbst über die Gesellschaft vorhandenen Theorien.[1] Vor allem ist es eine
praxisbezogene Verbindung funktionalistischer und konflikttheoretischer
(z.
B. dialektischer, marxistischer usw.) Ansätze sowie der Makro- und
Mikrotheorien, des Objektivismus und des Subjektivismus.
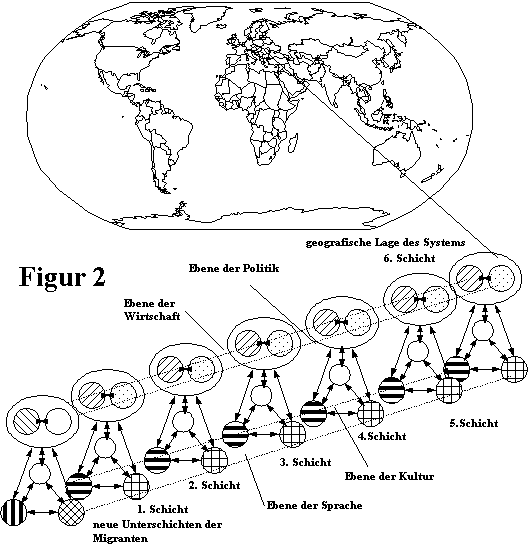
Der Autor hat
das Modell bereits 1975 entworfen. Auch die neuesten integrativen Ansätze
prominenter Sozialphilosophen und Theoretiker wie Habermas, Bourdieu und Giddens
haben in ihren Versuchen, die Vielfalt der Makro- und Mikrotheorien in einer
einzigen Theorie zu vereinigen, keine wesentlichen Fortschritte gegenüber diesem
Modell geboten.
Eine
hochindustrialisierte Gesellschaft wäre gekennzeichnet durch folgende vier
Ebenen, die ihrerseits in eine Mehrzahl soziologisch eindeutig abgrenzbarer
Unterbereiche zerfallen.
1.1 Religion – Kultur – Technologie – Wissenschaft – Kunst
1.2 Sprache – Kommunikation – Medien
1.3 Wirtschaft
1.4 Politik – Recht (Verfassung, Verwaltung, Gerichtsbarkeit) – Ethik
(Sprache-Kultur-Wirtschaft-Politik)-System
Die Kriterien einer jeden Ebene sind natürlich auf alle anderen zu beziehen. (Es gibt daher eine Wissenschaft der Wirtschaft oder umgekehrt eine Wirtschaft der Wissenschaft, eine Ethik der Kultur und umgekehrt eine Kultur der Ethik usw. Die Beziehungen wären kombinatorisch durchzudenken und erforderlichenfalls für praktische Untersuchungen heranzuziehen.)
Hinsichtlich
jeder Ebene sind für jede Gesellschaft die empirischen Realitäten möglichst
ausführlich anzusetzen, insbesondere auch alle wissenschaftlichen Theorien, die
sich mit diesen Bereichen der Gesellschaft beschäftigen. Selbstverständlich
beeinflussen bestimmte, einander oft bekämpfende Theorieansätze die Zustände in
einer Gesellschaft. (In Russland vor der Perestroika gab es beispielsweise
nur eine einzige Wirtschafts- und Sozialtheorie und nur eine Philosophie.
Alle anderen Modelle wurden unterdrückt.)
Es erscheint für die Sozialtheorie unerlässlich, alle Ebenen einzeln und auch in ihren Wechselwirkungen zu beachten. Habermas hat etwa in seinen ursprünglichen Analysen des Spätkapitalismus neben der rein ökonomischen Ebene auch die politische integriert (erhöhter Staatseinfluss)[2], ist aber in seinen weiteren Analysen durch die Einbeziehung der Sprach- und Kommunikationstheorie zu völlig neuen, komplexeren Positionen (Universalpragmatik und Postulate kommunikativer Vernunft)[3] gelangt.
Für jeden westlich differenzierteren Nationalstaat ist die Gliederung in Schichten typisch. Wer die Verbindung der Theorie der Ebenen der Gesellschaft mit jener der Schichten vernachlässigt, beraubt sich wichtiger Kriterien, die besonders für die Diskriminierungsforschung unerlässlich erscheinen.
Die wirtschaftlich-funktionelle Teilung der Gesellschaft spiegelt sich in den Schichten, die als miteinander verbundene, aber auch im Gegensatz zueinander stehende
6 unterschiedliche (Sprache-Kultur-Wirtschaft-Politik)-Untersysteme
gelten können. Die Gliederung erfolgt nach dem Beruf, ist also auf Positionen in den Wirtschaftsprozessen bezogen. Die Gliederung repräsentiert in der Gesellschaft strukturell verfestigte Diskriminierungselemente, die man grob als Unterdrückung oder strukturelle Gewalt (kondensierte Diskriminierungsstruktur) bezeichnen könnte.
Für die westlichen Industriestaaten setzen wir folgende Schichten an:
6. Schicht: große Selbständige, höhere Angestellte
und Beamte, freiberufliche Akademiker
5. Schicht: kleine Selbständige, Bauern inbegriffen
4. Schicht: mittlere Angestellte und Beamte
3. Schicht: niedere Angestellte und Beamte
2. Schicht: Facharbeiter
1. Schicht: Hilfsarbeiter und angelernte
Arbeiter
Wir können die Verbindung zwischen Ebenen und Schichten durch den Aufriss unseres Modells auf der nächsten Seite verdeutlichen:
Dieser
Schichtaufbau impliziert eine Wertorientierung aller
Gesellschaftsmitglieder untereinander. Zu beachten ist, dass sich die
Schichtposition eines höher positionierten Facharbeiters bis in die Bereiche der
mittleren Schichten verschieben kann, wie sich umgekehrt die Position der
"kleinen" Selbständigen über mehrere Bereiche der Mittelschicht erstreckt.
Korte/Schäfers erwähnen einen Statusaufbau der BRD nach Hradil:
Oberschicht
ca.
2 %
obere Mittelschicht ca. 5 %
mittlere Mittelschicht ca. 14 %
untere Mittelschicht ca. 29 %
unterste Mitte/oberes Unten ca. 29 %
Unterschicht
ca.
17 %
"unterste Unterschicht"
ca.
4 %
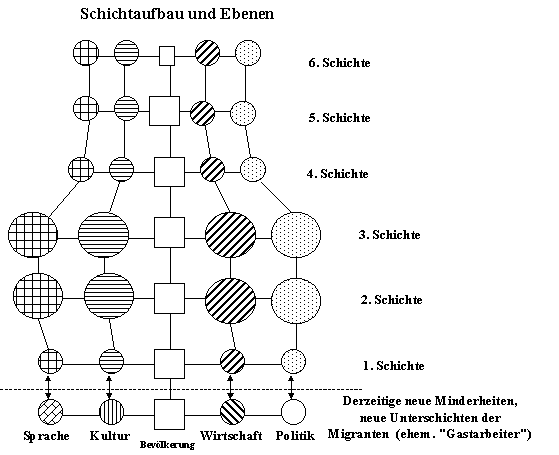
In dieser Schichtung wird auch dem Umstand Rechnung getragen, dass Teile der Arbeiterschaft bis in die untere Mittelschicht, Teile der kleinen Selbständigen ("alter Mittelstand") bis in die obere Mittelschicht und schließlich Angestellte und Beamte ("neuer Mittelstand") von der oberen Mittelschicht bis zur untersten Mittelschicht reichen.
Jede Schicht ist durch andere (Sprache-Kultur-Wirtschaft-Politik)-Eigenschaften gekennzeichnet, wobei die Position im Gesamtaufbau bereits die Erziehungsmethoden, kognitive Strukturen usw. prägt. Die Homogenisierungstendenzen der medialen Oberflächen suggerieren eine bestimmte Nivellierung des Schichtaufbaus. Hierdurch tritt häufig auch in der soziologischen Forschung eine Verschleierung dieser nach wie vor äußerst effektvollen Über- und Unterordnungsmechanismen der Schichtung ein.
Eine Schicht
im Gesamtmodell ist in der Figur 2 gleichsam eine Scheibe, die herausgeschnitten
etwa folgende Gestalt und folgende Eigenheiten besitzt:
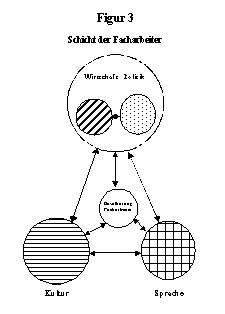
Jede Schicht hat anderen Einfluss auf die wirtschaftlichen und politischen Prozesse und ist selbst ein anderer Faktor.
Ein
besonderes Problem stellen ethnische Minderheiten dar. Sie sind sehr
häufig nicht einfach aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit einer
bestimmten Schicht zugeordnet, sondern wir beobachten gesonderte ethnische
Schichtungen und Marginalisierungen. Diesbezüglich stellen die
Untersuchungen des Autors unter (Pf 01) und (Pf 01a) ausführliches Material
unter Berücksichtigung der bisherigen Forschung zur Verfügung.
Im Zentrum des Raummodells der Figur 2 befindet sich die jeweilige Wohnbevölkerung einer Schicht, wie in Figur 3 klarer erkennbar ist. Hierbei wird einerseits die prägende Wirkung der Ebenen und die Position im Gesamtaufbau auf den Einzelnen (hier des Facharbeiters und seiner Familie) sichtbar, andererseits zeigt sich die Wirkung, die von den einzelnen Menschen auf die Ebenen und die anderen Schichten ausgeht. Die von Habermas betonte Relation von System und Lebenswelt (Ha 81) wird hier theoretisch sichtbar gemacht. Für jeden Menschen sind im Weiteren Geschlecht und Lebenszyklus Determinanten der sozialen Bestimmung. In allen derzeitigen Gesellschaftssystemen ist etwa die Stellung der Frau in allen gesellschaftlichen Kriterien hinsichtlich Ebenen, Schichten, auch der ethnischen Schichten, diskriminierend verfestigt.[4]
Die Dimension des Raumes (Staatsgrenzen, Verkehrswege, Ressourcen usw.) ist unerlässlicher Aspekt bei der Erkenntnis sozialer Phänomene. Die geografische Verteilung der Bevölkerung auf dem Staatsgebiet (ethnische Streuung) bedingt weitere typische soziale Differenzierungen und Eigentümlichkeiten. Alle bisherigen Elemente (Ebenen, Schichten usw.) sind mit diesem Faktor und seinen Wirkungen durchzudenken. In den aktuellen Sozialtheorien hat besonders Giddens auf die Dimension des Raumes Wert gelegt.[5]
Die bisherigen Ansätze sind in den soziologischen Richtungen des Funktionalismus besonders betont. Die folgende Dimension bringt die konflikttheoretischen (meist auch dialektisch orientierten) Schulen in das Modell ein. Während das bisherige Raummodell eher ein ruhiges Fließen von Funktionen suggeriert, betrachtet diese Dimension die Vielzahl und Arten der Gegensätze und Konflikte in der Gesellschaft.
Innerpsychische Gegensätze werden nach den verschiedenen Schulen der Psychologie unterschiedlich begrifflich gefasst.
Die wichtigsten Richtungen der zeitgenössischen westlichen Psychologie sind:
Behaviorismus und Positivismus (auch Rassenpsychologien und -physiologien),
Psychoanalyse mit Nachfolgern Freuds,
Humanistische Psychologie,
Transpersonale Psychologie,
Grund- oder Ur-Psychologie, (Or-Om)-Psychologie.
Es handelt sich hier um eine grobe Vereinfachung.[6] Es wäre aber völlig ausgeschlossen, hier alle Schulen und Aspekte aller Schulen der Psychologie auch nur in Übersicht anzugeben. Psychologien haben jeweils ihre eigenen Erkenntnistheorien und deren Grenzen.
Wir erwähnten bereits, dass die soziologische Theorienbildung sowohl Makro- als auch Mikrotheorien entwickelte, wobei schließlich in integrativen Ansätzen versucht wurde, die beiden Gruppen zusammenzuführen. Mikrotheorien gingen hierbei vom Individuum aus, versuchten vor allem gesamtgesellschaftliche Phänomene und Entwicklungen aus der individuellen Ebene heraus zu erklären.
·
(Tr
00) führt als Gruppen von Mikrotheorien etwa an:
das individuelle Programm – Verhaltens- und
Nutzentheorien (Homans,
Opp, Coleman);
das
interpretative Programm – Symbolischer Interaktionismus und Phänomenologie
(Mead, Blumer, Husserl, Schütz, Berger/Luckmann);
Geschlecht als soziale
Konstruktion, die wir bereits oben erwähnten.
Theorie des kommunikativen Handelns (Habermas);
die Gesellschaft der Individuen (Elias);
Kultur, Ökonomie, Politik und der Habitus des Menschen (Bourdieu);
Dualität von Handlung und Struktur (Beck, Giddens);
Konstituierung des Geschlechterverhältnisses (Bilden, Hannoveraner
Ansatz, Thürmer-Rohr, Hochschild).
Es wäre
völlig ausgeschlossen, die Summe aller Ansätze und ihre Verflechtungen hier
inhaltlich zu berücksichtigen, wenn auch kein Zweifel daran besteht, dass alle
diese Theorien in unser Modell integriert werden können. Sie sind ja selbst
Teile des Systems und beeinflussen ständig die Entwicklung desselben.
In einer vereinfachten Form versuchen wir fortzufahren:
Mit dem Hineinleben in die Gesellschaft ab der Geburt werden soziale Identitäten gebildet, wobei die bereits bisher erwähnten Faktoren 1 – 4 (für jeden unter-schiedlich) mitwirken. Hier sind alle geltenden Theorien der Sozialisation zu berücksichtigen.
Im Rahmen der sozialen Identität entwickelt jeder die
Auswahl-, Bewertungs- und Ordnungsstrategien und -muster
seines Verhaltens gegenüber den anderen Mitgliedern des Systems, seine Geschlechtsidentität, aber auch seine "ökonomische Identität" (in Beruf und Freizeit, als Konsument und Produzent usw.), auch seine religiöse, kulturelle und national geprägte Identität. Der Gender-Ansatz in der feministischen Theorie kann in unserem Modell alle seine Diskriminierungsaspekte finden.
Vergegenwärtigen wir uns dies wiederum an einem Facharbeiter in der obigen Figur 3. Aus den ihn in seiner Familie usw. umgebenden Zuständen der Schicht in wirtschaftlicher, politischer, kultureller und sprachlicher Hinsicht entwickelt er seine Identität, sehr wohl aber im Gesamtgefüge der anderen Schichten, die über und unter ihm sind. Vor allem die Summe dieser Über- und Unterordnungen sind für seine Identität sehr wichtig, sie lassen ihn erkennen, dass er in vieler Hinsicht diskriminiert, unterbewertet und missachtet ist.
Unser Raummodell macht sichtbar, dass soziale Gegensätzlichkeiten
a) auf den einzelnen Ebenen der Gesellschaft und zwischen den Ebenen 1 – 4,
b) in der einzelnen Schicht und zwischen den Schichten,
c) zwischen den Menschen,
d) in der geografischen Dimension
und in allen Kombinationen von a – d bestehen.
Die Auffassung ist jedoch um alle in der Gesellschaft bestehenden Konflikttheorien (z. B. Marxismus, Sozialismus, funktionalistische Konflikttheorie, Krisentendenzen des Spätkapitalismus usw.) zu erweitern.
Die Einführung des Konfliktbegriffes eröffnet auf allen von uns eher funktionalistisch erschlossenen Ebenen, Schichten und demographischen Dimensionen die vorhandenen Prozesse und Motive.
Wir ermöglichen dadurch, ungenau gesagt, zu erkennen, dass Gesellschaft stets Struktur und Spannung gleichzeitig ist, wie überhaupt das gleichzeitige Denken der Gesellschaft als Struktur (relativ stabilisierte Spannung) und Prozess (Änderung der Spannungsrelationen) notwendig ist, um nicht allzu einfach zu verfahren.
Wir vervollständigen unser Modell, indem wir im Schichtaufbau auf die Distanz der verschiedenen Ebenen (Sprache, Kultur, Wirtschaft, Politik) hinweisen, welche die Spannungs- und Konfliktpotentiale aus innerpsychischen und sozialen Konflikten andeuten. Die Menschen der jeweiligen Schicht werden im Zentrum eingezeichnet.
Ohne eine bestimmte Theorie der Zeit zu benutzen (alle diese Theorien sind im Modell bereits angesetzt), wird deutlich, dass hinsichtlich aller 5 bisherigen Faktoren, einzeln und aller in allen Wechselwirkungen, die Zeit (als geschichtliche Dimension) einen weiteren Faktor bildet. In den modernen Sozialtheorien beachten vor allem Elias und Giddens den Zeitfaktor explizit.
In (Pf 01, S.
122 ff.) und (Pf 01a, S. 218 ff.) werden diese Zustände eines westlichen
Nationalstaates mit den Parametern des Urbildes gemäß dem obigen Grundplan in
Verbindung gebracht. Es ist nötig, gleichsam in allen Ecken und Enden des
Systems die diskriminierenden, verzerrenden Strukturen und inadäquaten sozialen
Fixierungen einzelner Gruppen festzustellen. An jedem Punkt kann man eine
Weiterbildung im Sinne der Prinzipien des Urbildes beginnen, indem man
Modellbegriffe (Musterbegriffe) ausarbeitet.
Sind in einem einzelnen Sozialsystem (Staat usw.)
diese Prinzipien eingeführt, werden die derzeitigen allgegenwärtigen
diskriminierenden Spannungen, Konflikte und Strukturen zunehmend eliminiert und
durch Strukturen von Synthese, Ausgleich, Harmonie und Balance bei hochgradiger
Individualität, Pluralität und Polymorphismus ersetzt. Die Utopie eines solchen
Gesellschaftsmodells müsste etwa eine Nebenordnung aller Schichten
beinhalten. Auch die Minoritäten sind bei Aufrechterhaltung maximaler
multikultureller Pluralität undiskriminiert integriert.
Die Überleitung aller diskriminierenden menschlichen
Beziehungen in diese Universalität darf ausschließlich nur durch gute und
friedliche Mittel erfolgen. Politische Gewalt, psychischer und physischer
Terror, Umsturz, List, Intrige, politische Instrumentalisierung und
Ideologisierung und alle ähnlichen negativen Mittel sind auszuschließen.
Da es sich hier um einen westlichen Nationalstaat handelt, wollen wir dieses System als Sozialsystem1 bezeichnen, das in seinen soziologischen Eigenheiten als grünes System gelten soll.
Es wäre naiv, die Probleme nicht zu sehen, die hier bereits entstehen:
* Unsere Sätze bis hierher gehören einmal vorerst dem Sozialsystem1 an, haben daher grüne Färbung, sind nicht systeminvariant.
* Wenn auch das Modell des Sozialsystems1 in der Lage ist, alle Begriffe aufzunehmen, die im Sozialsystem1 jemals gebildet werden sollten (darin sind natürlich auch alle Begriffe und Ansätze der Postmoderne und der interkulturellen Philosophie enthalten, neben allen anderen Epistemen der Rationalität), so haftet ihnen doch Subjektivität und Intersubjektivität bezogen auf das grüne System an.
* Die reflexiven Leistungen (Selbstthematisierungen), welche von der System-heorie vorausgesetzt werden, etwa in (Ha 81), (Wa 90) und (We 95), unterliegen hinsichtlich ihrer Begrifflichkeit einer System-Immanenz und System-Vermitteltheit bezüglich des Sozialsystems1. Es ergibt sich bildhaft die Frage, inwieweit reflexive Selbstthematisierungen der Systemtheorie die Grünheit ihrer eigenen Sozialsystem1-Immanenz und -Vermitteltheit abschütteln könnten.
Wir benehmen uns – kurz – in unseren Reflexionen über die eigene Gesellschaft bereits immer so, als könnten wir sie unabhängig von unserer eigenen Grünheit betrachten, über sie grün-unabhängige Aussagen machen, Meta-Aussagen, die farblos, unabhängig von jeglicher Evolution unseres eigenen Systems, ja aller Systeme wären. Wir haben dies oben auch für die Postmoderne nachgezeichnet. Auch sie erhebt sich über die eigene Implikationen in eine Farblosigkeit, die sie nicht rechtfertigen kann. Auch sie repliziert "transzendentale Gewalt" nach Waldenfels. Obwohl wir so denken, hat diese Art des Denkens derzeit noch keinerlei wissenschaftlich gesicherte Grundlage. Wir halten fest: Die Aussagen über das Sozialsystem1 durch einen Vertreter des Systems (auch Welsch, Habermas, Lyotard, Waldenfels, Kimmerle usw.) besitzen keinerlei theoretisch gesicherte Grundlage jenseits der Grünheit des Systems.
Die theoretischen Grundlagen der wissenschaftlichen Forschung werden zusätzlich diffuser und unsicherer, wenn wir Aussagen über zwei Systeme treffen wollen, was in den verschiedensten Wissenschaftsdisziplinen wie Ethnologie und interkultureller Philosophie, aber auch in der politischen Praxis geschieht und letztlich auch in der Postmoderne geschehen muss (vgl. Waldenfels' Begriffe von Egozentrik, Logozentrik und Ethnozentrik).
Wir
vergleichen ein Sozialsystem1:
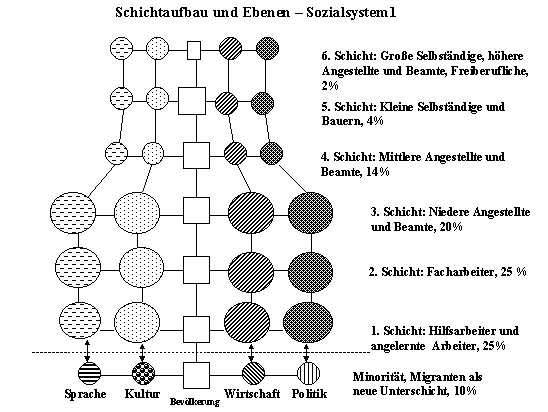
mit einem Sozialsystem2:
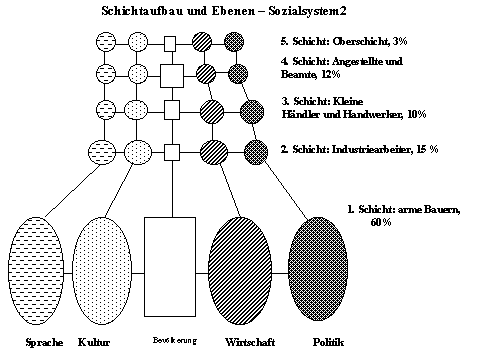
Das Sozialsystem2 sei bestimmt durch vom grünen Sozialsystem1 erheblich abweichende Determinanten. Die Schicht der Industriearbeiter ist äußerst schwach ausgebildet, kleine Händler und Handwerker, die es in den grünen Systemen überhaupt nicht mehr gibt, bevölkern als vom Lande geflüchtete Landlose die Slumgebiete der Megastädte, in ländlichen Gebieten hingegen fristen 60 % der Bevölkerung als Kleinbauern in unterschiedlichen Modellen der Abhängigkeit von Großgrundbesitzern ihr Leben. Ihre Subsistenzwirtschaft (informeller Sektor) ist ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor, der in der Berechnung des BSP nicht auf-scheint. Die Schicht der Beamten und Angestellten ist ebenfalls deutlich schwächer ausgebildet. Großfamiliäre Solidarbindungen sind häufig die einzige Möglichkeit des Überlebens.
Wir nennen es daher lila und bezeichnen es als Sozialsystem2. Das lila System stelle etwa ein Entwicklungsland dar, das an der "Peripherie" des Weltsystems liegt (z. B. Somalia).
Zwei farbige Systeme, die Weltbilder zweier unterschiedlich gefärbter Systeme, können weder mit den Begriffen eines der beiden Systeme noch mit denen eines dritten, anders gefärbten Systems adäquat aufeinander bezogen werden (Problem der Transformationsadäquanz von Begriffen).
In einem Gleichnis kann dies folgend veranschaulicht werden:
Sozialsystem1 entspräche einem PKW und Sozialsystem2 einem von Pferden gezogenen Wagen. Man kann einen PKW mit den Konstruktionsbegriffen eines Pferdewagens beschreiben oder umgekehrt den Pferdewagen mit den Begriffen eines PKW. Offensichtlich werden aber beide Beschreibungen inadäquat sein. Zu prüfen ist weiterhin, ob der Beschreibende des PKW nur die Pläne des Sozial-systems1 kennt oder beide und umgekehrt, ob der Beschreibende der Pferdekutsche nur die Pläne des Sozialsystems2 kennt oder beide. Dieser Vergleich ist nicht abwertend gemeint, versucht aber darauf aufmerksam zu machen, dass die funktionalen und inhaltlichen Zusammenhänge in den beiden Systemtypen äußerst unterschiedlich sind.
Wissenschafter und Politiker bedenken zumeist viel zu wenig diese funktionellen Unterschiede der Systemtypen, weil sie ihre Systembrillen nicht ablegen können oder wollen. Politischen Strategen und den ihnen zuarbeitenden theoretischen Eliten des Sozialsystems1 dienen diese Differenzen, seit der Kolonialzeit instrumentalisiert, der Legitimierung unterschiedlichster Arten von Interventionen, mit der häufig politische Eigeninteressen (Ressourenoptimierung) verfolgt werden.
Jedem wird klar sein, dass in diesem lila System alle politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sprachlichen Uhren anders gehen als in einem Sozialsystem1.
Hier wird neuerlich deutlich, dass unsere auf diesem Blatt geschriebenen Sätze selbst, um sinnvoll sein zu können, einem System ohne Sozialsystem1-Immanenz usw. angehören müssen, wobei das Problem des infiniten Regresses der Reflexions- und Sprachstufen auftritt. Subjekte aus Sozialsystem1/Sozialsystem2 benutzen bei der Betrachtung (Forschung) von Sozialsystem2/Sozialsystem1 die mit jeweiliger Systemimmanenz und Systemvermitteltheit behafteten, gefärbten Begriffe (Brillen) und können daher durch diese Begriffsverzerrung (Farb- und Glasverzerrung) das Sozialsystem2/Sozialsystem1 nur mangelhaft erkennen, woraus sich eine durch die jeweilige Systemimmanenz und Systemvermitteltheit bedingte Inadäquanz der Erkenntnis ergibt.
Unsere hiesigen Aussagen (z. B. auch alle Überlegungen Waldenfels' und anderer postmoderner oder interkultureller Philosophen, welche das Problem des [europäischen] Ethnozentrismus behandeln), befinden sich zweifelsohne auf einer Überebene, Metaebene 1.
Wir sprechen in der
Metaebene und treffen darin Aussagen, die aber in keiner Weise formal oder
inhaltlich wissenschaftlich oder erkenntnistheoretisch gesichert sind.
Es ergibt sich:
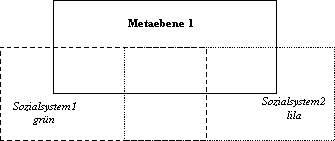
Die Nichtbeachtung dieser wissenschaftlichen Situation und aller damit verbundenen ethnozentrischen Erkenntnisverzerrungen ist eine empirische Tatsache. Christo Stoyanov erwähnt in einem Beitrag zur Transformationsforschung, dass die Wissenschafter in den postsozialistischen Staaten den Eindruck haben, dass ihre westlichen Kollegen ihnen die "überlegenen westlichen Systemwerte" und ihre vermeintlich evolutiven Universalien in Form einer Kolonialisierung, einer AIDS-Infektion und eines aggressiven Vordringens vermitteln wollen. In Machtasymmetrie nützten sie ihre dominante Stellung aus, in völliger Ignoranz gegenüber der Eigenart der osteuropäischen Geschichte.
Die zunehmenden kommunikativen Verschränkungen im Weltsystem aktualisieren die Problemstellung. Die Frage nach der Begründungsmöglichkeit eines farblosen Bezugssystems, welches unabhängig von der Evolution aller Systeme im Weltsystem und unabhängig von der manipulativen Dominanz des "überlegenen Systems" Grundlage der Systembetrachtung sein kann, wird an Dringlichkeit zunehmen.
Das Sozialsystem3 hat den umseitigen Aufbau und rote Färbung. Das Volk besteht aus zwei Stämmen, die ohne Veränderung nach folgenden Strukturen geordnet sind. Der Stamm Kufé ist aufgrund eines Entstehungsmythos dem Himmel, der Zahl 3 und den Vögeln zugeordnet und gilt als männlich; der Stamm Salagu, ist der Erde, der Zahl 4 und den Vierbeinern zugeordnet und gilt als weiblich. Die Untergliederung des Stammes erfolgt in 3 Gruppen, die nach Tieren benannt sind, denen gegenüber die Gruppe besondere Vorschriften einzuhalten hat. Die Großfamilien in den Untergruppen werden nach Teilen des zugehörigen Tieres benannt. Die Siedlungsformen der Dörfer erfolgen strikte nach dem kosmischen Aufbau der Gesellschaft. Im Zentrum, dem heiligen Bezirk, leben die wichtigen religiösen, politischen, technischen und sozialen Funktionsträger, deren politische Funktionen aus dem Ursprungsmythos abgeleitet und legitimiert sind. Die politischen Strukturen sind durch kosmische Strukturen und deren Verhältnisse bestimmt. Man spricht von einem animistischen Weltbild.
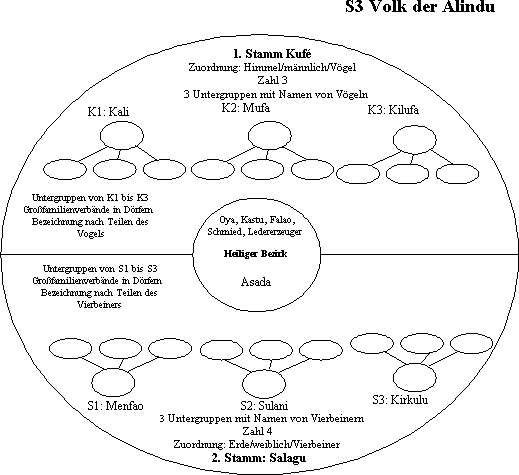
Der Oberste, der Oya, ein Kufé, ist eine hieratische Erscheinung, besitzt geheimes Wissen, ist Hüter allen Lebens und Vermittler zu allen das Leben fördernden Kräften und ist auch eine Synthese von männlich und weiblich. Der Kastu, auch ein Kufé, ist Opferpriester, der Falao, ein Kufé, ist Vorbereiter von Zeremonien und Festen. Der Schmied, ein Kufé, ist dem nächtlichen Lauf der Sonne zugeordnet und steht in mythischer Verbindung mit Feuer und Eisen. Seine Arbeit gilt als magische Handlung. Der Asada, ein Salagu, ist Magier, Seher, Heiler, Behüter und Diener der Erde.
Es gilt eine Dreiseelenlehre. Jeder hat eine Seele A (Ahnenseele) des Urgroßvaters, die Seele C aus dem der Gruppe zugehörigen Tier und die Seele B, die im Grabe des Urgroßvaters verblieben ist. Die Kunst ist magisch-kultisch-rituell bestimmt und fügt sich in Form und Inhalt in die kosmischen Bezüge.
Ein privates oder kollektives Eigentum an Boden gibt es nicht. Die Salagu haben das Verteilungs- und Ordnungsrecht über Grund und Boden. Die Erde ist ein Individuum, eine Frau. Die Bodenbestellung muss wie die Zeugung eines Menschen durch Mann und Frau erfolgen. Die territoriale Hoheit ist kosmisch legitimiert, die Form der Siedlung kosmisch strukturiert.
Das System ist schriftlos, bildet also eine rein orale Kultur, was bekanntlich wichtigen Einfluss auf die Komposition und Gewichtung der Bewusstseinselemente und Erkenntnisstrukturen, aber auch auf soziale Gliederung (Autoritätsbildungen), die Verteilung und Verbreitung von Wissen und evolutive Perspekiven besitzt.
Es ist klar, dass in diesem System die "Uhren
anders gehen" als in den beiden vorherigen Typen. Ein Mensch mit grünen Brillen
und grünen Begriffen wird das rote System verzerrt sehen und umgekehrt wird ein
Salago, der erstmals nach Paris kommt, mit seinen roten Begriffen unsere Welt in
einer uns nicht zugäng-lichen Form erkennen und erfahren.
Wenn wir auch nur in oberflächlicher Weise versuchen, diese 3 Systemtypen im Weltsystem zu vergleichen, treten die obigen Probleme in potenzierter Form auf.
Die theoretischen Vorbehalte gelten sinngemäß. Unsere hiesigen Aussagen befinden sich zweifelsohne auf einer neuen Metaebene.
Es ergibt sich:
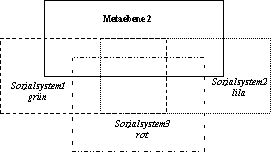
Auch hier gilt, dass diese Aussagen in keiner Weise formal oder inhaltlich wissenschaftlich oder erkenntnistheoretisch gesichert sind.
Unsere Interpretation des Lebens von Eingeborenenstämmen, hier der Alindu, die ökonomischen Theorien eines amerikanischen Bankiers hinsichtlich der Inflation in einem Entwicklungsland (Sozialsystem2), die Evolutionsthesen der ehemaligen sozialistischen Länder, die Gegensätze zwischen mythologischen und rational-wissenschaftlichen Weltbildparadigmen in der New-Age-Bewegung, die islamische These von der Evolution der Religionssysteme, die reaktiven Entwürfe religiös-nationaler Identitätsstrategien in den Entwicklungsländern, der Cargo-Kult, die Sätze von Levi-Strauss über den Mythos der Mythologie in der Einleitung zu "Mythologica I", die Theorie des Ganzen als einer originären Pluralität heterogener Gebilde bei Welsch, die Überlegungen Waldenfels' über Eigenes und Fremdes, die Evolutionstheorie des Weltsystems von Wallerstein oder Modelski, sie alle sind betroffen von der erwähnten Problematik, besitzen eigentlich keine theoretische Begründung.
Wir gehen davon aus, dass ein farbloses "neutrales" Begriffs- und Beschreibungssystem, welches diese Probleme bewältigt und vermeidet, nur dann gefunden werden kann, wenn der Mensch in Gott Begriffe finden kann, die für die göttliche wie für die menschliche Rationalität konstitutive Geltung besitzen. Diese Rationalitätsstrukturen sind nach Ansicht des Autors in der Grundwissenschaft Krauses enthalten, aus der hier teilweise Gesichtspunkte vorgestellt werden.
Das Weltsystem, ähnlich wie einen Einzelstaat, als ein in sich geschichtetes System zu betrachten, wurde in verschiedener Weise in der Forschung versucht (Heinz, Senghaas, Russert, Lagos), aber inzwischen wieder aufgegeben.
Die Analogie
ist infolge der unterschiedlich hohen Integrationsgrade im Weltsystem in
ökonomischer, politischer, sprachlicher und kultureller Hinsicht mit Vorsicht
anzuwenden. Andererseits ist nur über ein Modell, welches ähnlich unserem
Raummodell in Figur 2 für den Nationalstaat aufgebaut werden müsste, die
Möglichkeit gegeben, die Unterdrückung im Weltsystem sichtbar zu machen. Die
Weltbilder im Gesamtsystem sind daher durch die Vielzahl inadäquater sozialer
Fixierungen gesellschaftlicher Gruppen und ganzer Völker (Staaten-gruppen)
miteinander verbunden. Den Begriff "inadäquat" müsste man hier wiederum farblos
verstehen, der Maßstab wären die Kategorien der göttlichen Vernunft.
Derzeit
wird das Machtgefüge eher durch die Begriffe von Zentrum,
Halbperipherie und Peripherie gefasst, aber auch hier müsste eine
strukturelle Beziehung in einem Modell erfolgen, die unserem Raummodell
nachgebildet wird und in Figur 4 berücksichtigt ist. Die Einteilung in erste,
zweite und dritte Welt ist seit dem Zusammenbruch des "realen Sozialismus"
unbrauchbar geworden. Die ehemalige "zweite Welt" ordnet man derzeit auch bei
den "Transformationsländern" ein. Die Einordnung der Länder in eine Skala von
"Entwicklungsändern" mit zunehmenden Armutsparametern ist infolge der
unterschiedlichen Statistiken und Messmethoden bei UNO, Weltbank und OECD selbst
umstritten.
Der Umstand
der Ungleichheiten zwischen den drei Systemtypen Zentrum, Halbperipherie und
Peripherie im Weltsystem ist Gegenstand unzähliger Analysen unterschiedlichster
theoretischer Ansätze. Der Hinweis auf einige Basisdaten reicht aber, um das
Ausmaß real sichtbar zu machen. In der Messung von Entwicklung ist bekanntlich
das BSP als Indikator als unzureichend erkannt worden. Neben dem von ihm
erfassten Bereich der Produktion für den Markt und Lohnarbeit sind der
informelle Sektor, die Teilhabe an politischen Gestaltungsprozessen, die
Menschenrechtssituation, die kulturelle Teilhabe, der Zugang zu modernen
Kommunikationsmitteln und der Alphabetisierungsgrad, die Beschäftigungschancen,
der Tribalismus, die Aufwärtsmobilität im Schichtsystem sowie die Zustände des
Ökosystems wichtige Faktoren. Auch der "Human-Development-Index" der UNO,
bestehend aus Lebenserwartung, Bildung und Lebensstandard, reicht nicht aus.
Nach unserem Dafürhalten müsste für jedes Land ein Schichtmodell in der
oben für die Sozialsysteme1 und 2 dargestellten Differenzierung
erstellt werden, um zu wissen, wie für die Rechtlosen und Unter-privilegierten
"die Uhren wirklich gehen".
Die reichsten
Länder der Welt (20 % der Weltbevölkerung) haben ihren Anteil am
Welt-Bruttoinlandsprodukt gegenüber dem ärmsten Fünftel der Welt von 3:1 im
Jahre 1820 auf 74:1 im Jahre 1997 vergrößert. Ein Fünftel der Weltbevölkerung
von 6 Milliarden Menschen lebt in absoluter Armut (1,08 US-Dollar pro Tag).
Besonders betroffene Gebiete sind Schwarzafrika, Indien, Pakistan und
Bangladesch. Setzt man die Armutsgrenze auf 2 US-Dollar pro Tag fest, lebt fast
die Hälfte der Menschheit (47 %) in Armut. Geringes Einkommen bedingt
mangelhafte Gesundheit, mangelnde Bildung, labile Verankerung in sozial
unsicheren Identitäten und politische Machtlosigkeit. Die durchschnittliche
Lebenserwartung, die Kinder- und Altensterblichkeit sind deutlich höher, die
ärztlicher Versorgung entsprechend beschränkt. Interne politisch-wirtschaftliche
Machtverhältnisse bestimmen neben externen Faktoren die Trends auf Verbesserung
der Lebenssituation der Bevölkerung (z. B. Unterschiede zwischen Kuba, Sri Lanka
und Vietnam einerseits und Südafrika andererseits).
Die AIDS-Katastrophe belastet die ohnedies bereits düsteren Parameter in Schwarzafrika (Afrika südlich der Sahara) zusätzlich (hohe Zahl an Infizierten, Todesfälle, Wahrscheinlichkeitsrate der Ansteckung, volkswirtschaftliche Verluste und hohe Kosten der medizinischen Behandlung und der Vorsorge-Tests). Schwarzafrikas Anteil an der Weltbevölkerung beträgt 10,7 % (642 Millionen), es hat eine Wirtschaftsleistung von 2,4 %, der Anteil am Welthandel beträgt 1,3 %. Die 7,1 Millionen Schweizer exportieren mehr als ganz Schwarzafrika. Nur 0,7 % der grenzüberschreitenden Investitionen fließen nach Schwarzafrika. Der Anteil der Internetzugänge beträgt 0,2 %.
Von den 793 Millionen Unterernähten in der "dritten Welt" weisen 234 Millionen (ca. 30 %) einen Fehlbedarf von 1 – 19 % auf, 333 Millionen (ca. 42 %) fallen in die Kategorie eines Fehlbedarfs von 20 – 34 % und bei 226 Millionen (29 % der Hungernden) beträgt das tägliche Kaloriendefizit mehr als 34 % mit schlimmsten Folgen chronischer Unterernährung. Diese Daten stehen im zynischen Gegensatz zum Ausmaß der Übergewichtigen und Fehlernährten in den Industriestaaten. Der mit der Pflege und Ernährung von Hunden und Katzen in den Industriestaaten betriebene Aufwand rundet das Bild bedenklich ab.
In den reichen Ländern des Nordens, auch "Industrieländer" genannt, lebt rund ein Fünftel der Weltbevölkerung. Ihr Anteil an den erwirtschafteten Gütern und Dienstleistungen der Welt (Welt-Bruttoinlandsprodukt) beträgt 80 %. Das reichste Fünftel der Menschheit kontrolliert 73 % des Welthandels und verzehrt 45 % des weltweiten Angebotes an Fleisch und Fisch, wobei ein Drittel dieser Bevölkerung übergewichtig ist. 62 % der Energie mit den entsprechenden Folgen für Treibgasausstoß und Klima braucht der Norden für sein "Wohlstandsmodell". Der Trend zur Ausweitung dieser Vormachtstellung wird durch die Dominanz in den neuen Medientechnologien eher begünstigt, da diese in ökonomische und dirigistische Effizienz umgesetzt werden können. 96 % der Internet-Anschlüsse finden sich in den OECD-Ländern.
53 % der grenzüberschreitenden Exporte finden innerhalb der Industrieländer (Nord-Nord-Handel) statt. Industrieprodukte wie Maschinen, Transportmittel, elektronische Geräte, Chemieprodukte usw. sind wertmäßig die bedeutendsten Exportgüter (70 % aller Exporte). Sie werden überwiegend im Norden hergestellt und gekauft. Exporte vergleichbarer Waren des Südens in den Norden werden häufig durch Protektionismus behindert. Allgemein kommt es zu einer Verschlechterung der Terms of Trade.
Weitere 30 % des Welthandels fallen in den Bereich des Nord-Süd-Handels. Der Süd-Süd-Handel innerhalb der Entwicklungsländer macht rund 17 % der welt-weiten Exporte aus.
Im Jahre 1999 kamen lediglich 26 % der Warenexporte aus den "Entwicklungsländern" (85 % der Weltbevölkerung), den Rest der Exporte bestritten die Industrieländer unter sich. Gerade die wertmäßig wichtigsten Handelsströme fließen noch immer weitgehend zwischen den Industrieländern.
Die internationale Ölpreispolitik stellt einen weiteren marginalisierenden Machtfaktor zulasten der Entwicklungsländer dar, die nicht selbst Öl exportieren. Die Steigerung des Rohölpreises pro Barrel im Jahre 2000 um rund 10 US-Dollar (um 36 %) bedingte für 64 Entwicklungsländer, die Öl importieren müssen, eine zusätzliche Belastung von 43 Milliarden US-Dollar. Ein Großteil der ärmeren Länder muss zur Deckung des unabwendbaren Ölbedarfes für Energie, Verkehr und chemische Produkte öffentliche Kredite aufnehmen, was zu weiterer Verschuldung führt.
Die Preise für agrarische und mineralische Rohstoffe sind, über längere Zeit betrachtet, rückläufig, was eine weitere Belastung für jene Länder darstellt, deren Exporte weitgehend aus derartigen Rohstoffen (Kaffee, Kakao, Baumwolle, Kupfer usw.) bestehen. Besonders vom Export von Rohstoffen abhängig sind etwa Burundi, Nicaragua, Ecuador, Kenia und Zimbabwe. Der Versuch, über mengenmäßige Begrenzungen (Beschränkung des Angebots) den Preis zu erhöhen (Kaffee, Kakao, Zucker, Bananen, Bauxit, Kautschuk, Öl u. a.), wurde nur mangelhaft umgesetzt. Besonders die Agrarexporte der Entwicklungsländer unterliegen protektionistischen Abschottungen der Industrieländer, die damit ihren eigenen Agrarsektor schützen (Zucker, Getreide, bestimmte Gemüse, Tabak, Wein, Olivenöl usw.). Der jährliche Einnahmenentgang der Entwicklungsländer liegt nach Schätzungen des IWF bei etwa 40 Milliarden US-Dollar.
Ein wesentlicher Teil der
Globalisierungsdynamik geht an den Entwicklungsländern vorbei. So landeten
beispielsweise von den rund 1,1 Billionen US-Dollar, die im Jahre 2000 als
Direktinvestitionen im Ausland angelegt wurden, nur
15,9 % in den
Entwicklungsländern, wo immerhin 85 % der Weltbevölkerung leben. Von weltweiten
Kapitalmarkttransfers (4,3 Billionen US-Dollar) erreichten im Jahre 2000 gerade
5,5 % die Entwicklungsländer. Ein Großteil der Gelder, die in den Süden fließen,
verteilt sich auf einige wenige Länder. Die 10 reichsten Schwellenländer – allen
voran China – vereinigten 1999 74 % der 3.-Welt-Direktinvestitionen, weitere 19
% entfielen auf die anderen Länder mit "mittleren Einkommen". Nur 6,8 % der
Direktinvestitionen flossen in die Länder mit niedrigem Einkommen, in denen 40 %
der Weltbevölkerung leben. Zusätzlich gibt es häufig einen Kapitalabfluss aus
den instabilen Entwicklungsländern in das Zentrum des Weltsystems.
Die Überschuldung der Entwicklungsländer ist ein weiteres, destabilisierendes Element. Nach Aufstellung der Weltbank flossen im Jahre 1999 rund 265 Milliarden US-Dollar (45,3 Milliarden öffentliche Gelder, 219,2 Milliarden private Direktinvestitionen, Bankkredite, Anleihen und Aktienkäufe) in die Entwicklungsländer, wobei Handelsbeziehungen und Mittel der "technischen Zusammenarbeit" nicht mitgezählt werden. Diesem Kapitalstrom steht ein gigantischer Schuldendienst gegenüber, der zur Zahlung von Zinsen und Tilgungen vom Süden an den Norden zu zahlen ist. Im Jahre 1999 waren dies 340 Milliarden US-Dollar. Viele Länder der dritten Welt sind gegenüber ausländischen Regierungen, internationalen Institutionen (Weltbank, IWF) und privaten Banken derart erstickend verschuldet, dass eine Rückzahlung dieser Schulden ebenso unwahrscheinlich wie eine soziale Entwicklung des Landes ist. Dies gilt auch für einige Länder mit mittleren Einkommen. Die Schulden übersteigen das Jahreseinkommen in Indien um 114 %, in Argentinien um 429 %, in Burundi um 850 %, in Bolivien um 220 %, in DR Kongo um 717 %, in Brasilien um 380 %, in Nicaragua um 662 %, in Peru um 340 % und in Sambia um 518 %. Enorme Anteile der Exporteinnahmen werden daher häufig gleich wieder für die Bedienung des Schuldendienstes ausgegeben. Die Überschuldung bedingt eine erhebliche Einschränkung des ökonomischen, politischen und sozialen Handlungsspielraumes, führt zu inneren Destabilisierungen der Systeme, die wiederum häufig das Investitionsklima verschlechtern, die Arbeitslosigkeit zumindest nicht verringern und damit evolutive Fortschritte unmöglich machen.
Selbstverständlich werden die Parameter durch endogene Faktoren der einzelnen Staaten, wie Korruption der Eliten, Nepotismus, Tribalismus, Fehlentscheidungen bei Richtung der Investitionen, Überbetonung der Militärausgaben und ähnliche desintegrative Trends, zusätzlich verschlechtert. Der theoretische Disput darüber, ob exogene oder endogene Gründe für die Unterentwicklung verantwortlich seien, ist in dieser Form nicht zielführend, da es sich um eine systemtheoretisch komplexe Verbindung beider Bereiche handelt. Die HIPC-Initiative (für heavily indebted poor countries) von Weltbank und Währungsfonds zum Erlass von Schuldenanteilen bei Erstellung eines nachprüfbaren Planes zur Armutsverminderung (Poverty-Reduction-Strategy-Paper) sind erste Versuche der Linderung.
Die meisten Kriege und bewaffneten Konflikte (mehr als 90 %) sind heute "innerstaatliche" Auseinandersetzungen. In der "dritten Welt" sind bewaffnete Konflikte häufig ausgelöst oder verschärft durch desolate Entwicklungsperspektiven, ethnische oder tribale Rivalitäten, Kämpfe um die Vorherrschaft in schwachen Staaten oder religiöse Konflikte, die häufig nur als instrumentalisierte Aufladung echter Ressourcen- und Interessenkonflikte fungieren. In vielen Ländern des Südens hat der Staat sein Gewaltmonopol verloren, wenn er es je besessen hat. Bewaffnete Gruppen (z. B. warlords), in ihren Zielen, Ideologien und Methoden kaum noch zu identifizieren, kämpfen um politischen Einfluss oder versuchen ökonomisch wichtige Faktoren (etwa im Rohstoffbereich) unter Kontrolle zu bekommen. Ausländische Staaten manipulieren u. U. derartige Konfliktlinien um das Land im bestehenden Zustand zu destabilisieren oder ihnen genehmere Eliten zu etablieren. Wesentliche Konfliktherde sind derzeit (alphabetisch): Afghanistan, Burundi, Demokratische Republik Kongo, Elfenbeinküste, Indien/Pakistan, Irak/Westen, Israel/Palästina, Kolumbien, Liberia, Nepal, Sudan, Tschetschenien. Waffenproduktion und -exporte (Massenvernichtungswaffen, Biowaffen und leichte Waffen) stellen selbst einen wichtigen Wirtschaftsfaktor dar. Der global operierende Terrorismus ist eine neue Spezialvariante der Konfliktstrukturen im Weltsystem. Laufende UNO-Friedensmissionen versuchen bestimmte Konflikte einzudämmen oder zu mildern.
Die geschilderten Zustände in der "dritten Welt" bedingen, dass staatsinterne und internationale Flüchtlingsströme zu einem gewaltigen politischen und humanitären Problem werden. Weltweit sind 70 Millionen Menschen auf der Suche nach einer neuen Heimat. Weitere Probleme in diesem Zusammenhang sind z. B. der Patentschutz bei Medikamenten, der Treibhauseffekt mit Klimaveränderungen, die Wasserknappheit, die Regenwald-Verluste, die Probleme der Kinderarbeit und der Einsatz von Kindern als Soldaten.
Die obigen Basisdaten zeigen bereits eklatante Ungleichgewichte und Unterdrückungspotentiale zwischen den drei Ländergruppen im Weltsystem. Wir sind aber unbedingt genötigt, als eine mächtige Instanz über den einzelnen Staatengruppen das hochabstrakte, den kruden ökonomischen Rationalitätsgesetzen eines Casino-Kapitalismus (mad money) folgende System der internationalen Finanzmärkte anzusetzen, dessen Machtpotentiale die daneben ablaufenden traditionellen Wirtschaftsprozesse zwergenhaft erscheinen lassen. Die funktionelle Verbindung derselben mit wenigen Staaten des Zentrums ist offensichtlich.
Die im Rahmen der Globalisierung rechtlich ermöglichte Ausweitung der Transaktionen der internationalen Finanzmärkte führte dazu, dass täglich etwa 1,5 Billionen US-Dollar umgesetzt werden. Der weitaus größte Teil dieser Summe hat keine realwirtschaftlichen Bezüge, sondern dient einzig und allein der Geldvermehrung an sich. Dieses Geld wird angelegt, um kurzfristige Gewinne durch Spekulationen auf Kursschwankungen bei Devisen, Aktien oder Wertpapieren, deren Börsenplatzierung wiederum weitgehend ebenfalls von Erwartungshaltungen – nicht etwa von den tatsächlichen wirtschaftlichen Stärken oder Schwächen – bestimmt wird, zu erzielen. Die elektronische Geschwindigkeit der exklusiven digitalen Systeme des Datentransfers macht es möglich, innerhalb kürzester Zeit die geringsten Bewertungsdifferenzen an den Börsenplätzen in Spekulationsgewinne und -verluste umzuwandeln. Mehr als 80 % der Anlagen an den internationalen Finanzmärkten haben eine Laufzeit von weniger als 2 Monaten, viele sogar nur von wenigen Stunden. Diese spekulativ bestimmten Bewertungsprozesse börsennotierter Unternehmen bedingen einen gewaltigen Druck auf alle Dispositionen der betroffenen Firmen.
Der mangelnde
Bezug zur Realwirtschaft wird schon aus den Größenverhältnissen deutlich. 1997
lag beispielsweise das Volumen des Welthandels (Waren und Dienstleistungen) bei
ca. 6,8 Billionen US-Dollar, das sind knapp 2 % der Umsätze der Finanzmärkte.
Selbst bei Hinzurechnung der Auslandsinvestitionen und anderer Beteiligungen
bleibt der realwirtschaftliche Anteil bei höchstens 5 %. Diese spekulativen
Geldanlagen besitzen umgekehrt erhebliche Auswirkungen auf die Realwirtschaft,
da sie ungeheuere Geldmengen binden und die Attraktivität anderer Investitionen
reduzieren. Versuche, diese spekulative Zweckentfremdung des Geldes zu
verhindern oder zu reduzieren (z. B. mittels der Tobin-Steuer), hatten bisher
keinen Erfolg.
An den Börsen und in den Handelsräumen der Banken und Versicherungen, bei Investment- und Pensionsfonds hat eine neue politische Klasse die Weltbühne der Macht betreten, der sich kein Staat, kein Unternehmen und erst recht kein durchschnittlicher Steuerbürger mehr entziehen kann: Global agierende Händler in Devisen und Wertpapieren, die einen täglich wachsenden Strom freien Anlagekapitals – weitgehend frei von staatlicher Kontrolle – dirigieren und damit über Wohl und Wehe ganzer Nationen entscheiden können, sind eine neue globale Machelite.
Der Manager eines "hedge fund",
einer Spezialfirma, die ihren Investoren über besonders intelligente, aber auch
riskante Anlagekonstruktionen regelmäßig zwei- bis dreistellige Renditen
verschafft, reist fünf- bis zehnmal im Jahr in die wichtigsten Markt- und
Wachstumsregionen der Welt. Er meint: "Die aktuellen Daten hat jedermann im
Computer, was aber zählt, ist die Stimmung, sind die unterschwelligen Konflikte. Und
Geschichte, immer wieder Geschichte. Wer die Historie eines Landes kennt, kann
besser vorhersehen, was bei akuten Krisen geschehen wird."
Man beachte die gefährliche Schraube: Die internationale Spekulation fördert in den labilen Staaten die sozialen Konfliktpotentiale, die etwa durch die Freisetzung von Arbeitskräften entstehen und nutzt dann wiederum ihr Insider-Wissen hinsichtlich dieser Konflikte für weitere Spekulationsgewinne aus.
Der Vater dieser neuen Kapitaltheorie, Friedman, sagt etwa: Erst die freie Fluktuation des Kapitals über alle nationalen Grenzen hinaus ermöglicht seine optimale Verwertung (Effizienz). Die Finanzmärkte sind zu den Richtern und Geschworenen jeder Wirtschaftspolitik geworden. Der Machtverlust für die Nationalstaaten sei nur gut. Verloren gegangen sei den Regierungen damit die Möglichkeit, ihre Macht durch überhöhte Steuern und inflationstreibende Verschuldung zu missbrauchen. Dies erzwinge gesunde Disziplin.
Ein Spezialproblem des amerikanischen Börsensystems hat im Jahre 2002 hybride Entwicklungen zum Einsturz gebracht. Die extreme Ausrichtung der Beurteilung von Unternehmen nach ihrem Börsenwert (Shareholder-Value-Philosophie), die über gewaltige Stock-Option-Programme auch das persönliche Einkommen der Manager aufs Engste mit dem Aktienkurs ihrer Unternehmen verbindet, führte über die Prozedur der "Performance"-Messung zur Ermittlung der Gewinnerwartungen anhand der Bilanzzahlen in Drei-Monats-Zyklen. Sowohl Bilanzfälschungen als auch das Dazukaufen von Umsatz mittels neuer Kredite waren die bedenkliche Folge. Mit dem wirtschaftlichen Zusammenbruch der Konzerne verfielen die Kurse ihrer Aktien bei gewaltigen Verlusten für die oft kleinen Anleger.
Es gibt etwa 100 Standorte (Offshore-Finanzmärkte) über den Erdball verstreut, wo internationale Anlagefirmen Geld ihrer Kunden verwalten, das jeglicher Steuerkontrolle entzogen ist (Fluchtkapital). Dies ist ein weiteres, unkontrolliertes Element der internationalen Wirtschaftsprozesse.
Die folgende Figur 4 versucht, die skizzierten Zustände im Weltsystem grafisch zusammenzufassen. Das Zentrum, mit der global agierenden Instanz der Finanzmärkte deutlich verbunden, besteht aus hierarchisch gegliederten Staaten (S1, S2 usw.), die durch die "westlichen" Werte und Eigenheiten in sprachlicher, kulturell-religiöser und wirtschaftlicher Hinsicht bestimmt sind. Ein einzelner Nationalstaat wurde vorne in Figur 2 in seinen Einzelheiten dargestellt. Er besitzt, was in manchen Forschungsrichtungen, die auch Makro- und Mikroebenen verbinden, betont wird, interne Zentren und Peripherien. Das Zentrum beherrscht in sprachlicher, kultureller, wirtschaftlicher und politisch-militärischer Hinsicht die beiden anderen Staatengruppen, die wiederum in hierarchisch gegliederte einzelne Staaten zerfallen.
Die Staatengruppen we2 und
we3 sehen sich dem enormen Würgegriff und einer Dominanz des Zentrums
ausgesetzt und befinden sich zweifelsohne in einer strukturellen Abhängigkeit.
Ihre Entwicklung ist überwiegend eine Reflexentwicklung. Werden diese
Unterdrückungs- und Benachteiligungsstrategien voll sichtbar, mutet der offene
Druck auf Übernahme der als überlegen erklärten
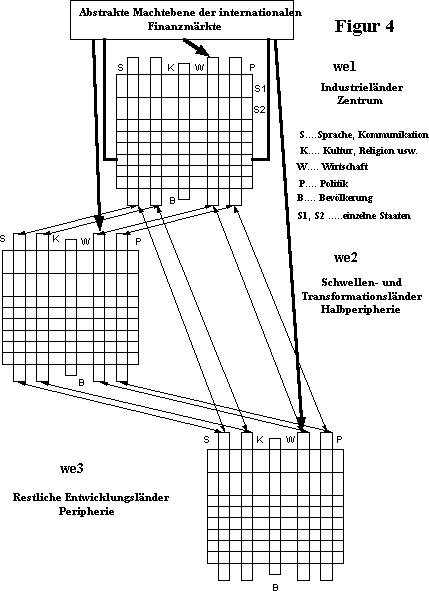
"westlichen" Werte- und Zivilisationsstruktur sowie die arrogante Überlegenheitsdoktrin des Zentrums allein schon funktionell als äußerst zynisch an. Wie sollen Länder, die durch Dominanz anderer derart in ihrer Entwicklung behindert werden, die reale Möglichkeit besitzen, diese Transformation zu leisten? Dabei sehen wir noch von der uns beschäftigenden Frage ab, ob die Wertesysteme des Zentrums überhaupt die "evolutionären Universalien" darstellen, um eine Globalintegration der Menschheit zu gewährleisten.
Globalisierung als globale Integration der Weltgesellschaft soll nach der westlichen Evolutionsdoktrin darin bestehen, dass die anderen Systemgruppen we2 und we3 ihre bisherigen wirtschaftlichen, politischen, kulturell-religiösen und kommunikativ-sprachlichen Parameter in jene des Westens umwandeln und von diesen inhaltlich völlig und in allen Systemdetails, die wir vorne in Figur 2 darstellten, durchdrungen und getränkt werden.
Die Aufgabe, die wir uns am Beginn im Grundpan stellten, besteht im Gegensatz hierzu darin, die historischen Systemgruppen, die wir als we1, we2 und we3 bezeichneten und hier skizzierten, mit neuen, universalen Grundlagen menschlicher Gesellschaftlichkeit zu kontrastieren und zu konfrontieren, welche als Urbild der Menschheit einerseits inhaltlich völlig neue Grundlagen für die Weltgesellschaft darstellen, uns aber anderseits schlagartig klar machen, dass die Wertsysteme des derzeitigen westlichen hegemonialen Zentrums keineswegs die religiös-kulturellen, politischen, wirtschaftlichen und sprachlich-kommunikativen Inhalte und Parameter für eine harmonische Integration aller Teilsysteme in einer globalen Weltgesellschaft bilden können. Sie sind, bildlich ausgedrückt, lediglich pubertäre Gesellschaftsmodelle von 18-Jährigen, die versuchen, noch jüngere Gruppierungen, die andere evolutionäre Mängel und Disproportionen besitzen, zu beherrschen und unter Druck zu halten, indem sie ihren kleinen Altersvorsprung schonungslos ausnutzen. Sie konstruieren aus ihrem wirtschaftlichen, politischen, religiös-kulturellen und kommunikativen Vorsprung die Legitimation für eine imperial-hegemoniale Vormachtstellung und ein Definitionsmonopol für alle evolutiven Varianten im Weltsystem, die sie noch dazu mit Arroganz – früher als Kolonialismus und heute als Postkolonialismus – über globale wirtschaftliche, kulturelle und kommunikative Steuerungsprozesse den übrigen Systemen aufzwingen.
Die Wertsysteme und dominierend ökonomischen Rationalitätsstrukturen der 18-Jährigen sind gerade nicht der Maßstab für die Entwicklung eines ausgewogenen Globalsystems. Festzuhalten ist, dass die hier neu vorgeschlagenen "evolutiven (Or-Om)-Universalien" innerhalb der Färbungen und vor allem Disproportionen, Verzerrungen, Einseitigkeiten, Hypertrophien und Pervertierungen der westlichen Zivilisationsstrukturen nicht einmal erkannt werden können, sondern dass, wie wir oben zeigten, es wissenschaftlicher Neuerungen bedarf, um das Tor zu diesen Perspektiven aufzustoßen. Bildlich gesprochen, sind die Sozialstrukturen des Westens zu flach und begrenzt, um die neuen Grundlagen zu fassen. Die sozialen, wirtschaftlichen, politischen, kulturell-religiösen und sprachlichen Ausformungen des Zentrums sind, wenn man sie mit der Sozialstruktur eines erwachsenen Systems vergleicht, eben der Pubertät entsprechend, in allen ihren Gliedern nicht aufeinander abgestimmt, in den Inhalten der einzelnen Glieder und ihrer Ausdifferenzierung teilirrig, vor allem sind bestimmte Glieder der Gesellschaftlichkeit überhaupt noch nicht entwickelt, und schließlich fehlt die Integration aller gesellschaftlichen Faktoren des Systems in die Urprinzipien der neuen Universalien. Es geht also nicht um eine Variation der bereits bestehenden, zu flachen sozialen Rationalitätsstrukturen des Westens, sondern um eine inhaltliche Vertiefung aller ausgebildeten Elemente und ihrer komplexen Beziehungen in einem neuen Gerüst. Durch diese Vertiefung in die Urprinzipien werden bisher nicht entwickelte Elemente neu erschlossen und alle bestehenden Elemente inhaltlich verändert und neu verankert.
Das Urbild und seine Ideen sind daher vom heutigen Sozialzustand qualitativ äußerst weit entfernt. Der 18-Jährige und seine jüngeren Geschwister erfahren erstmals, wie sie sich als Erwachsene verhalten sollten. In ihrer Jugendlichkeit werden sie die belehrenden Perspektiven vielleicht nicht verstehen wollen, werden sie in ihrer "Aufgeklärtheit" als reaktive, längst überholte phantastische oder verrückte Schwärmerei abtun und ablehnen. Im derzeitigen und künftigen Evolutionsprozess wird das Urbild daher nur langsam und zunehmend als Maßstab dienen. Auch der Umstand, dass nur gute, friedliche Mittel zur Veränderung und bei der Verbreitung zulässig sind, wird den Ansatz als "weltfremd" erscheinen lassen.
Da wir alle Teilsysteme der globalen Menschheit, we1, we2 und we3, gleichzeitig im Auge behalten, ergeben sich hier gleich einige heikle Fragen. Wie ist das Verhalten des Lehrers des Urbildes zu sehen, der den streitenden Schülern den Spiegel ihrer mangelnden Entwicklung vorhält? Handelt es sich um eine neue Art des Kolonialismus, wo der Überlegene mit Gewalt und Herablassung die "Untermenschen" einer primitiven Kultur und Lebensweise "höher bildet", womöglich wieder unter Vermischung mit seinen eigenen (verschleierten) kulturellen und politischen Interessen?[7] Ist es wieder der Duktus des Missionars, der, wie häufig die bisherigen Missionare, das bestehende kulturelle, politische und soziale Leben (z. B. das Leben der vorne gezeigten Alindu) zerstört? Ist diese Evolutionstheorie eine weitere Anmaßung der Aristokratie im Weltsystem, um, wie früher im imperialen Kolonialismus, die deklarierte Unterwertigkeit ganzer Völkergruppen und Rassen instrumentalisierend für Dominanz und Ausbeutung nutzbar zu machen? Eignet sich das Urbild etwa, wie es in den ehemaligen sozialistischen Staaten des Marxismus-Leninismus geschah, als diktatorische Zwangsdoktrin, um ganze Staaten und Völker in eine "glückliche Zukunft" zu prügeln? Wird hier nicht wieder ganzen Staatengruppen der Eindruck ihrer Unterwertigkeit, Primitivität und Zurückgebliebenheit vermittelt?
Dass dies nicht der Fall ist, zeigen einerseits die völlig neuen wissenschaftlichen Grundlagen, auf welche hier die Weltgesellschaft gestützt wird, zeigen aber andererseits vor allem die ethischen Maximen[8], die sie zur Verwirklichung ihrer selbst fordern.
Auf dem Schulhof dominieren die 18-Jährigen die Jüngeren durch ihre altersbedingte Überlegenheit. Die Lehrpersonen, welche ihnen diese neuen gegenseitigen und globalen Beziehungen vorschlagen, lehren sie gerade nicht durch gewaltsame Dominanz. Sie lehren nicht eine bestimmte Gruppe neue, womöglich verfeinerte, Herrschaftsmechanismen anzuwenden, sondern versuchen Vorschläge zu machen, wie sie sich alle in allen ihren Beziehungen trotz des Altersunterschiedes zu einer reifen Gruppe zusammenschließen können (universalistische Evolution unter Überwindung der Evolutionsdifferenzen und unter Einsatz einer koordinierten gemeinsamen Evolutionsdynamik).
Ist die Lehre eurozentristisch? Ist sie wiederum ein Kind der von den Entwicklungsländern so verachteten westzentrierten Überlegenheitsdoktrinen? Unterliegt sie auch dem Verdikt Derridas, wonach die Strukturen westlicher Rationalität rassistisch und imperialistisch sind? Handelt es sich im Sinne der postkolonialen, poststrukturalistischen und interkulturellen Theorie um einen unzulässigen Universalismus, der wiederum ungerechtfertigt eine ideale gemeinsame Sprache der menschlichen Rationalität imperial postuliert. Interpretiert sie die Evolution des Weltsystems in den Kategorien euro-amerikanischer Evolutionstheorien, die als Instrumente der Bevormundung und Unterdrückung anderer Gruppen dienten? Ist sie ein Kind der humanistisch-idealistischen Aufklärung Europas, welche das Andere als deviant, inhuman und unmündig darstellt und sich letztlich als totalitär erweist, weil sie das Andere unterjocht und Differenzen bewusst verschüttet? Das Urbild ist nicht eurozentristisch, sondern (or-om)-menschheitszentristisch. Seine Rationalitätsstrukturen überschreiten jene der europäischen Aufklärung, welche u. a. Instrumente des Kolonialismus wurden. Gerade weil das Urbild mit seinen neuen Perspektiven alle Evolutionsideologien des Euro-Amerika-Zentrismus überschreitet und eine grundlegende Transformation des Weltsystems insgesamt anregt und rechtlich fundiert, ist es bisher wenig beachtet worden und wird auch derzeit im Wissenschaftsbetrieb nicht leicht Eingang und Anwendung finden. Wo es im Weltsystem letztlich seine soziale Wirkung am stärksten entfalten wird, bleibt ungewiss.
Die feministische Theorie könnte fragen, ob dieses Urbild nicht wiederum ein androzentrischer männlicher Gerichtshof der Vernunft sei. Ist es wiederum eine Gestalt menschlicher Vernunft, die selbst eine Instanz von Herrschaft darstellt? Erhält sie weiterhin die Grundstruktur der androzentrischen Vernunftkonzepte? Wird hier nicht wieder nur im Namen eines universellen Subjektes eine kognitiv instrumentell vereinseitigte Vernunft entfaltet? Ist das Urbild, zumal wir uns jetzt schon in einem postmodernen Dekonstruktivismus befinden, nichts anderes als die Rückkehr einer konservativen Essentialisierung? Wir werden versuchen zu zeigen, dass die hier entwickelten Begriffe der göttlichen Rationalität keineswegs autoritäre androzentrische Vernunftkonzepte fortsetzen. Schon vorne erwähnten wir bei den 5 Arten der Erkenntnisschulen, dass eben alle bisherigen – auch metaphysischen – Rationalitätsentwürfe sich als teilirrige Lösungen erweisen, die durch eine neue, nicht mehr androzentrische Struktur bestimmt sind. Eben damit entfernt sich dieses neue Konzept weit von den etablierten männlichen Gerichtshöfen der Vernunft, deren Positionen in vieler Hinsicht zu Recht in der feministischen Theorie kritisiert und demontiert werden.
Schließlich könnte man fragen, ob die hiesigen Ausführungen eine Sekte begründen, die Vertreter dieses Systems also in sektiererischer Weise eine Durchsetzung und Verbreitung derselben anzustreben hätten. Das wäre etwa mit der Vorstellung vergleichbar, dass alle Vertreter des pythagoreischen Lehrsatzes oder des "Baumes der geraden Linie" in Anhang 1 Anhänger einer Sekte seien. Die Lehre kann nur durch eigene Einsicht und Prüfung angenommen werden, nicht durch Zwang, Gewalt und Unduldsamkeit. Gegenüber allen anderen wissenschaftlichen Positionen besteht eine friedlich-kritische Haltung, da sich diese anderen Positionen bekanntlich als teilirrig und einseitig betonend erweisen. Lediglich ihre friedliche Weiterbildung ohne Zwang, List, Betrug und ohne andere "unmoralische" Mittel wird angeregt. Wenn man unter Doktrin eine durch Zwang gesellschaftlich erzwungene Einführung einer Ideologie versteht (z. B. Marxismus-Leninismus, rassischer Nationalsozialismus u. ä.), kann die Wesenlehre niemals eine Doktrin sein.
Wenn, wie hier behauptet wird, die Wesenlehre eine völlig neue Entwicklungsidee für Wissenschaft, Kunst und letztlich Politik und Wirtschaft liefert, dann ergibt sich daraus, dass auch die Theorie über die menschliche Entwicklung neu zu fassen ist. Wenn nämlich die bisherige Wissenschaft die neuen Grundlagen der göttlichen Rationalität nicht erkannt hat und nicht enthält, dann müssen auch alle ihre Evolutionstheorien mangelhaft gegenüber jener Entwicklungslehre sein, die sich aus den göttlichen Kategorien ergibt. Die bisherigen Evolutionstheorien, die wir im folgenden skizzenhaft und in Übersicht erwähnen, können dann nur teilirrige Segmente in dieser neuen, anders strukturierten Auffassung über die menschlichen Entwicklungshorizonte darstellen, die vorne in den Grundzügen geschildert wurde.
Mit
Sicherheit hat jedes soziale System aus seiner inneren Logik heraus oder gemäß
der Art, wie in ihm die Uhren gehen, seinem Entwicklungsstand entsprechende
Auffassungen über die Entwicklung. So wird im animistischen System der Alindu,
das wir vorne streiften, grundsätzlich eine statische Dynamik bestimmend sein.
Die Grundstrukturen zwischen Kosmos und Gesellschaft müssen heil erhalten
werden. Jedes Individuum ist im Rahmen der Seelenlehre teilweise die Inkarnation
eines Ahnen, es besteht also ein zirkulärer Wechsel der tribal formulierten
Seelengruppen. Der soziale Wandel erfolgt innerhalb klarer Korrespondenzen
zwischen Kosmos und Stamm. Im traditionellen indischen Kastensystem erfolgen die
Reinkarnationen der Gesellschaftsmitglieder nach karmischen Bedingungen
innerhalb der unveränderbaren Kasten. Im Transformationsprozess Indiens werden
derartige Evolutionsthesen von den "offeneren", westlichen, "moderneren"
überlagert und mit ihnen vermischt. In den sozialistischen Staaten gab es
zeitweise nur eine einzige Entwicklungstheorie des dialektischen und
historischen Materialismus. In einem westlichen Nationalstaat, wie wir ihn in
Figur 2 darstellten, hat sich im Bereich der Wissenschaft eine beinahe schon
unübersichtliche Vielfalt von Entwicklungstheorien über die Differenzierung des
eigenen und anderer Systeme gebildet. Die einzelnen individualisierten
Richtungen werden teilweise in neuen Verbindungen und Verschränkungen
zusammengefasst, Makro- und Mikrotheorien versucht man in eine Gesamtheit zu
bringen. Zwischen den einzelnen Schulen gibt es einen Konkurrenzkampf und eine
ideologisierende Verteilung der Schulen kann nicht übersehen werden.
Modelski[9] hat eine Systematik versucht, die hier als Beispiel "westlicher" Differenzierung der Evolutionstheorien dienen soll.
I. Darwinismus und
Neo-Darwinismus
Darwin, Hofstadter, Huxley, Parsons, Waddington, Stanley, Ruse, Dobzhansky, Chaisson, Mayr, Dennet.
II. Evolutionismus
Comte, Spencer, Kropotkin, Sanderson.
III. Evolutionäre Theorie
Roe/Gaylord,
Wilson, Mayr, Gould, Boulding, Boorman/Levitt, Barash, Corning, Morris, Nitecki,
Pollard, Lasszlo, Wright, Ayres, Smith/Szathmary.
IV. Evolutionäre
Erkenntnistheorie
Campbell, Popper, Parijs, Sober, Callebaut, Hull, Elster.
V. Evolutionäre Soziologie und
Lernen
Childe, Pringle, Campbell, Habermas[10], White/Losco, Masters,
Schubert, Scott, Masulli, Sanderson, Arnhardt.
VI. Kulturelle Evolution
White, Parsons, Bonner, Boyd/Richardson,
Barash, Csanyi, Durham, Rambo, Wilson/Sober.
VII. Evolutionäre Wirtschaftstheorien
Schumpeter, Alchian, Mensch, Boulding,
Nelson/Winter, Hirshleifer, Mokyr, Ostrom, Hodgson/Scepanti, Witt, Poznanski,
Murell, Anderson, England.
VIII. Evolutionäre Weltpolitik
Bagehot, Veblen, Haas, Modelski, Adler, Gaddis,
Richards, Zacher/Mathhew.
IX. Evolutionäre
Spieltheorie
Smith,
Axelrod, Boyd, Hines, Goldberg, Bender, Fogel.
X. Komplexitätstheorie
La Porte, Gottinger, Book, Gleick, Anderson, Bonner, Dyke, Yates, Waldorp.
Diese Aufstellung ist sicherlich unvollständig. Die marxistischen Ansätze sind eher ausgeklammert. Weiterhin fehlen eine Reihe von erkenntnistheoretischen Annäherungstheorien hinsichtlich der Evolution von Wahrheit. Es bedürfte eines eigenen Buches, um alle diese Theorien mit der Evolutionstheorie der Wesenlehre kritisch zu verbinden.
Inwieweit erweisen sich die geschilderten Theorien nach der vorne erwähnten Evolution der Erkenntnisschulen als mangelhaft?
a) Sie gehören selbst den Erkenntnisschulen (1) – (4) an und erreichen damit nicht die Evolutionsstufe der Erkenntnisschule (5), welche die Begründung der Wissenschaft an und in der unendlichen und unbedingten göttlichen Wesenheit vollzieht.
b) In der Unendlichkeit Gottes sind die Gesetze der Entwicklung des Lebens endlicher Wesen gegenüber bisherigen Evolutionstheorien neu erkannt.[11]
c) Aus der Grundwissenschaft ergeben sich für die Evolution menschlicher Gesellschaften neue Perspektiven, die in den bisherigen Evolutionstheorien, welche früheren Evolutionsniveaus angehören, nicht erkannt wurden und nicht erkannt werden konnten.
Daraus ergeben sich auch die Mängel der bisherigen theoretischen Weltsystemdebatte.
Die Weltsystemdebatte, ein Spezialgebiet der Evolutionsproblematik, besitzt im groben Überblick heute nach Ulrich Menzel[12] vier Positionen:
a) Klassische eurozentrische
Position
Sie wird etwa von Eric Lionel Jones, David Landes, John A. Hall vertreten und steht in der Tradition der europäischen Aufklärung. Sie geht von einer, je nach Autor unterschiedlich gewichteten, einzigartigen Konstellation naturräumlicher, politischer, sozialer und vor allem geistiger Faktoren in Europa aus, die dazu führten, dass wahlweise etwa seit dem Jahre 1000, seit der "Krise des Feudalismus", seit der Renaissance, seit der Reformation oder seit der Aufklärung entweder in Großbritannien zuerst und allein oder in Teilen Westeuropas ein alle gesellschaftlichen Dimensionen erfassender "großer Transformationsprozess" stattgefunden hat, der zu einem essentiellen Entwicklungsvorsprung gegenüber allen anderen Weltregionen führte.
Nach Landes ist die treibende Kraft der Weltgeschichte seit etwa 1000 Jahren die westliche Zivilisation mit ihren technischen, geistigen und institutionellen Errungenschaften. Unter den hier herrschenden Entwicklungsbedingungen (frühzeitige Überwindung der Scholastik, Trennung von Kirche und Staat, Durchsetzung der empirischen Beobachtung) bestand schon vor der Reformation ein idealer Nährboden für die spätere Entwicklung, während die zentralistischen und bürokratischen orientalischen oder altamerikanischen Großreiche trotz ihrer beachtlichen zivilisatorischen oder sogar technischen Höchstleistungen die freie Entfaltung des Individuums, des Unternehmertums, des Innovationsgeistes, der systematischen naturwissenschaftlichen Forschung (Erfindung der Erfindung) und deren industrielle Umsetzung behinderten oder ganz unterdrückten.
Die weitere Entwicklungsgeschichte wird als Diffusion des westeuropäischen Modells in andere Regionen der Welt interpretiert. Die mit Kolonialismus und Imperialismus erfolgende internationale Arbeitsteilung habe doch letztlich durch Prozesse der freiwilligen oder unfreiwilligen Diffusion der westlichen Ideen, der westlichen Technik und ökonomischen und politischen Staats- und Verwaltungsprinzipien, des Erziehungswesens, des westlichen Lebensstils positiv gewirkt und die systemimmanente Stagnation asiatischer, halbasiatischer, afrikanischer und altamerikanischer Produktionsweisen und Despotien aufgebrochen.
Das westliche Modell habe einen universalistischen Anspruch, könne daher von allen anderen durch "Verwestlichung" übernommen werden.
b) Revisionistische
eurozentristische Position
Sie wird vor allem von der Wallerstein-Schule, von Samir Amin, dem frühen André Gunder Frank und Frances V. Moulder vertreten. Die Entstehung des Kapitalismus wird auch hier in Europa etwa im 15. Jahrhundert lokalisiert, wobei aber nicht die internen geistigen und sozialen Antriebe die Transformation herbeigeführt hätten, sondern die externe ökonomische Rahmensetzung, nämlich der Fernhandel, die Etablierung einer internationalen Arbeitsteilung, die europäische Welteroberung, die anfängliche Plünderung und spätere Ausbeutung der Kolonien und der daraus resultierende Ressourcentransfer nach Westeuropa. Der westeuropäische Entwicklungsvorsprung resultiere jedenfalls erst aus dem Kontakt mit Afrika, Amerika und Asien und war nicht schon vorher gegeben. Kolonialismus und internationale Arbeitsteilung seien demzufolge auch die wesentlichen Ursachen von Entwicklungsblockaden und Unterentwicklung. Die negativen Effekte des Kolonialismus werden in den Vordergrund gestellt. Die Weltgesellschaft wird bei Wallerstein durch eine Hierarchie gekennzeichnet, welche in die Großregionen Zentrum, Halbperipherie und Peripherie gegliedert ist. Auch hier gibt es das diffusionistische Argument, aber in einer Variante der Dependencia-Theorie, wonach die ehemaligen Kolonien und andere Staatengruppen durch die Traditionen der wirtschaftlichen Abhängigkeit vom Zentrum in ihrer Entwicklung gehemmt seien.
c) Asienzentrierte Position
Sie wird etwa von Janet Abu-Lughod, K. N. Chauduri, Anthony Reid oder Warren I. Cohen und Kenneth Pomeranz vertreten. Sie orientiert sich zwar auch an einem weltsystemtheoretischen und damit globalistischen Ansatz, leugnet aber die Einzigartigkeit und Besonderheit des modernen Weltsystems westlich-kapitalistischer Prägung. Es habe auch schon im alten Orient, also im arabisch-indisch-chinesi-schen Raum, ein Weltsystem – nicht nur Weltreiche – im Sinne einer Weltwirtschaft durch Fernhandel und internationale Arbeitsteilung gegeben. Für Indien und China werden für bestimmte Zeiträume durchgängig – besonders in wissenschaftlich-technischer und kommerzieller Hinsicht – Entwicklungsniveaus konstatiert, die denen Europas zur Zeit der Renaissance weit überlegen waren und auch lange danach noch behauptet wurden. Erst die industrielle Revolution am Ende des 18. Jahrhunderts ließ den asiatischen Vorteil dahinschmelzen. Der Verlust der Dominanz dieser Weltsysteme sei nach dieser Position vor allem durch innerasiatische, im Besonderen isolationistische Tendenzen eingetreten. Einem orientalisch dominierten Weltsystem sei daher ein europäisch dominiertes gefolgt, das durchaus auch wieder von einem asiatisch dominierten abgelöst werden könnte. Es handelt sich hier also nicht um die positiv oder negativ gewendete Vorstellung eines einzigartigen Diffussionsprozesses globaler Reich-weite, der von Westeuropa ausgegangen ist, sondern um eine revisionistische Diffusionsthese (mit eher regionaler Reichweite), insofern solche Prozesse nicht nur exklusiv von Europa, sondern auch von Asien oder anderen Regionen ausgegangen sind und in Zukunft auch wieder ausgehen könnten.
Die Argumente von Pomeranz und der "Californian School" laufen etwa darauf hinaus, dass man in der Wirtschaftsgeschichte zwischen der "Welt" Asien und der "Welt" Europa bis zur industriellen Revolution wenig Unterschiede findet.
Nach diesen
Ansätzen stehen wir am Beginn eines asiatisch dominierten Weltsystems, nicht
durch Diffusion aus dem Westen, sondern durch innergesellschaftliche
Transformationsprozesse. Der Westen gerät aus innerge-sellschaftlichen Gründen
(American Decline und Eurosklerose) unter wachsenden Druck und hätte seinen
Zenit schon überschritten.
d) Radikal globalistische
Position
Vertreten durch den späten André
Gunder Frank und Barry Gills, die sich wiederum auf Blaut, aber auch Abu-Kughod,
Chauduri u. a. stützen. Demzufolge soll bereits seit 5000 Jahren ein
einziges Weltsystem existieren, dessen Zentrum sich in Jahrhunderte
langen zyklischen Bewegungen um die Welt bewegt. Damit relativiert sich auch die
prägende Kraft besonderer oder gar exklusiver europäischer Errungenschaften,
seien sie geistiger, institutioneller oder technischer Art. Die Gesellschaften
und Großregionen der Welt sind einem ausschließlich extern bedingten
Auf und Ab ausgesetzt, ihr Status im Weltsystem wird durch die relative
internationale Konkurrenzfähigkeit und die damit verbundene Positionierung in
der internationalen Arbeitsteilung bestimmt. Die Position in der Hierarchie des
Weltsystems wird durch die Zahlungsbilanz bestimmt. Nur noch globalen
Handelsbeziehungen wird eine entwicklungsdeterminierende Funktion zugebilligt,
während innergesellschaftliche Transformationsprozesse fast völlig ausgeblendet
werden. Der Begriff Kapitalismus erscheint daher als ein quasi zeit-loses
Phänomen und damit eine gesellschaftstheoretisch sinnentleerte Kategorie. Unsere
überkommene Sicht der Weltgeschichte und die ihr zu Grunde liegenden
Großtheorien seit der Aufklärung bis hin zu Braudel, Kindleberger,
Modelski/
Rasler/Thompson, Landes, Jones, Kennedy und Wallerstein, die alle
implizit den Zeitraum um 1500 als großen Einschnitt ansehen, seien das Produkt
eines ideologischen Eurozentrismus, an dessen Stelle eine wirklich globale, eine
"menschheitszentrierte" Perspektive zu stellen sei. Auch nach dieser These
stehen wir am Beginn eines asiatisch dominierten Weltsystems.
Wenn wir die
vorne erwähnten Entwicklungsgesetze der Wesenlehre auf die Inhalte dieser
Debatte anwenden, haben wir als Erstes eine Charakterisierung des westlichen
Zivilisationsmodells nach den Kriterien der Evolutionsphasen durchzuführen. Was
ist also unser Maß für die Beurteilung von Evolution? Es sind die Grundrisse der
menschlichen Gesellschaftlichkeit, wie sie sich aus der Grundwissenschaft
ergeben. Erst wenn man weiß, wie die geistigen und körperlichen Zustände eines
Erwachsenen gebaut sind, kann man die Zustände und das Verhalten eines
Menschen beurteilen, der noch im Wachstum steht und noch nicht seine volle Reife
erreicht hat.
Die umseitige
Tabelle gibt ein Gerüst für den Aufbau einer reifen, globalen Menschheit.
Jedes Element
von 1) – 4) ist mit jedem anderen Element 1) – 4) kombinatorisch vollständig,
inhaltlich und funktionell in Verbindung und Bestimmung zu sehen.
Daraus ergibt
sich, dass die westlichen Industrieländer (bildlich als 18-Jährige bezeichnet)
sich überwiegend in den Phasen II. HLA, 2 und II. HLA, 3 sowie in
Überschneidungen b (mit progressiven und reaktiven Kräften) befinden. Schon das
in Figur 2 entwickelte Modell eines Industriestaates zeigt die enorme innere
Differenzierung einzelner Systeme und Unterebenen, die relative Autonomie der
Ebenen und die Komplexität der Balancen zwischen allen Faktoren.
Aufbau der globalen Menschheit im "Urbild" (Pf 03)
|
Menschheitsbund | |||
|
1) Grund- personen |
2)
Tätigkeiten |
3)
Grund- formen |
4)
Äußere Geselligkeit |
|
Erdmenschheit |
Wissenschaft |
Rechtsverein (Staat), polit. System, Gesetzgebung,Verwaltung, Gerichtsbarkeit |
Verein der Menschheit mit Gott |
|
Verein von Staaten (Völkern) |
Kunst |
Religion |
Verein der Menschheit mit der Natur |
|
Staat (Volk, Nation), Minderheiten |
Verein von Wissenschaft und Kunst; Unterglieder: Wirtschaft, Technik, Kommunikationsform |
Tugend (Ethik) |
Verein der Menschheit mit Geistwesen |
|
Stammverein |
|
Schönheit (Ästhetik) |
Verein der Menschheit mit Verein von Geistwesen/Natur |
|
Stamm, Tribalismus |
Erziehung |
|
Verein der Menschheit mit Verein Urwesens mit Verein von Geist und Natur |
|
Familienverein, Großfamilienverbände |
|
|
|
|
Freie Geselligkeit, Gruppen, Vereine |
|
|
|
|
Freundschaft |
|
|
|
|
Familie |
|
|
|
|
Einzelmensch, Mann, Frau |
|
|
|
Wir führen
hier nochmals die Differenzierung der 4 Ebenen an:
1.1 Religion – Kultur – Technologie – Wissenschaft – Kunst
1.2 Sprache – Kommunikation – Medien
1.3 Wirtschaft
1.4 Politik – Recht (Verfassung, Verwaltung, Gerichtsbarkeit) – Ethik
Die Unterbereiche einer
jeden Ebene sind ebenfalls enorm weiter differenziert. Zu beachten ist, dass die
Unterbereiche selbst in weitere Einheiten ausgefächert sind, die jeweils
Teilrationalitäten vertreten (hohe Individualisierung und Autonomisierung der
Systemfaktoren). So sind etwa die Wissenschaft, die Kunst, die Politik, vor
allem die Wirtschaftspolitik nach Ideologiemilieus oder Interessenslagen, mit
Konfliktpotentialen gegeneinander positioniert. Die Auseinandersetzung zwischen
Wirtschaft, Gewerkschaften und dem parteipolitisch bestimmten Regierungskurs
einer Koalitionsregierung sei als Beispiele genannt. Ähnliche Konflikte gibt es
im Kunst- und Wissenschaftsbetrieb. Damit entsteht ein über relative
Gleichgewichtszustände streitender Partialrationalitäten hergestellter
fragil-stabiler, hochkomplexer Gesamtzustand des Systems, der noch dazu durch
externe Faktoren wie die internationale Konkurrenzlage der Wirtschaft, die
Zustände der Finanzmärkte und internationale Konflikte beeinflusst wird. Die
administrativen Steuerungspotentiale und -erfordernisse dieser differenzierten
und durch Konfliktpotentiale geprägten Gleichgewichtszustände nehmen ständig zu,
die Administrationen sind jedoch selbst Teil des Systems und daher im fragilen
Gleichgewicht selbst ein Faktor. Einschneidende Änderungen der Systemdaten über
Neuerungen erweisen sich angesichts dieser hohen Komplexität und der
Differenzierung der Gleichgewichtszustände der Ebenen und ihrer Untersysteme als
äußerst schwierig, weil das "Drehen an einer Schraube des Systems" alle anderen
Faktoren im Gleichgewichtszustand mitbeeinflusst und daher extreme Reformen die
Stabilität des Gesamtsystems in Gefahr bringen oder die politische Landschaft in
Richtung auf die Entwicklung radikaler Links- oder Rechtsideologien
hin verändert. Die hohe Sensibilität und Fragilität dieser Balancen im System
sind daher zu Recht als eine der größten Bedrohungen dieser westlichen
Systemtypen erkannt worden.
Der Vergleich
mit den Strukturen des Urbildes zeigt Asymmetrien, Hypertrophien, Krankheiten,
Auswüchse, Mängel, Unterentwicklungen bestimmter Faktoren. Schon im System
selbst werden bestimmte Erscheinungen als Schattenseiten erkannt. Ein
maßgeblicher Anteil der Lebensqualität der Industrieländer des Zentrums ist mit
einer historisch gewachsenen und sich verändernden, erzwungenen Abhängigkeit,
Ausnutzung, Unterdrückung, Ausbeutung anderer – weniger entwickelter – Systeme
verbunden, die wir oben skizzierten. Ein Teil des Entwicklungsvorteils ist daher
durch die Ausnutzung der "Schwächen" von Halbperipherie und Peripherie, etwa in
Kolonialismus und Postkolonialismus, erreicht worden. Die Entwicklungsrichtung
der betroffenen "jüngeren" Systeme ist in der Phase der Abhängigkeit maßgeblich
in einer durch die Interessen der dominierenden Staaten geprägten Weise
deformiert und präformiert worden, die auch nach dem Ende der Dominanz
eine ausgewogene autonome Entwicklung äußerst erschwert und belastet. Durch die
derzeitige kontrollierende Omnipräsenz der Staaten des Zentrums in den von ihnen
einseitig geprägten universalisierten Wirtschafts- und Finanzstrukturen
erscheint eine "echte" autonome Entwicklung der anderen Systemtypen nicht
möglich. Diese Mechanismen sind integraler Bestandteil des Wohlstandsmodells der
Industriestaaten.
Die
Lebenswelt des Einzelnen in der Schicht, die Autonomiegrade der
Persönlichkeiten (Männer, Frauen, Kinder), die Differenzierung der
Identitätsprofile sind grundsätzlich in den Industriestaaten in einer in der
bisherigen Geschichte nicht erreichten Form durch die Rechtsordnung zumindest
formal abgesichert und gewährleistet. Vor allem die Grund- und
Freiheitsrechte ermöglichen, natürlich nicht für alle im selben Ausmaß,
Entwicklungs- und Äußerungsmöglichkeiten. Der Komplexität und damit persönlichen
Undurchsichtigkeit des Systems entsprechend, ist die Identität des
Einzelnen ebenfalls komplex und enthält u. U. eine Vielzahl von teilweise
inkompatiblen Elementen, was zum Begriff der postmodernen
Patchwork-Identität oder der Theorie der postmodernen Persönlichkeit führte.
Nicht alle Menschen im System haben die gleiche Möglichkeit der Ausbildung
einer balancierten vielschichtigen Persönlichkeit. Die im Schichtsystem
sichtbare strukturelle Diskriminierung bedingt erhebliche Benachteiligungen der
unteren Schichten und vor allem der als neue Unterschichten lebenden
Migrantengruppen, deren Identitätsmilieus als äußerst schwierig und belastet zu
gelten haben.[13] Die erhöhte
Autonomisierung im Rahmen des Prinzips der Selbstverwirklichung bringt
einerseits Erweiterungen der Persönlichkeitsprofile, bedingt aber umgekehrt
Isolationsgrade des Einzelnen, die in anderen Systemtypen, in denen teils
autoritär erzwungene, teils durch die ökonomischen Notwendigkeiten erforderliche
Solidaritäten in (Groß-)Familien weiterhin bestehen, nicht denkbar wären. Die
Single-Kultur und die Labilisierung der Familienverbindungen mit der Ausbildung
von Patchwork-Familien und alleinerziehenden Elternteilen sind ebenso
Indikatoren dieser Entwicklung wie etwa das Schlagwort von der
"Entsolidarisierung". Dieser Systemtyp hat seine Formen der sozialen
Verwahrlosung, die sich von den aus ganz anderen Bedingungen stammenden Arten
der Verwahrlosung in den armen Entwicklungsländern unterscheiden. Die
Supermarktideologie als Logik der Postmoderne stellt in vielen Bereichen der
Gesellschaft – ähnlich wie am Warenmarkt – lediglich
unverbindliche
Identifizierungsangebote zur Verfügung, unter denen der
"mündige" Bürger selbst zu wählen hätte.
Die enormen
Integrationsprozesse, etwa im Rahmen der EU-Osterweiterung zweifelsohne wichtige
Schritte im Sinne der Bildung der im Urbild vorgesehenen kontinentalen
Staatenbünde[14] oder
Bundesstaaten, bilden für die betroffenen Staaten stabilisierende Momente, die
Abschottung dieser Gruppierung von den anderen Systemtypen (Festung Europa)
erhöht aber die äußere Bedrohung und die Entwicklung von Krisen.
Innere
Fragilität und äußere Bedrohung infolge der teils elenden Zustände der übrigen
Systemtypen im Weltsystem lassen die Frage entstehen, ob die innere Logik und
Flexibilität der westlichen Industriestaaten und ihrer aristokratischen
Herrschaft in der Lage sein werden, diese Ungleichgewichte im Weltsystem durch
eine Rücknahme der Eigeninteressen auf friedliche Weise in einen stabileren
Gesamtzustand für alle Teilsysteme umzugestalten.[15]
Was bedeuten
diese Analysen für die 4 Positionen in der Weltsystemdebatte? Im Sinne der
Evolutionslogik der Wesenlehre erscheint das westliche System als
differenzierter und nach den Evolutionsparametern als weiter entwickelt als die
beiden anderen Typen. Daraus wird aber keineswegs eine grundsätzliche
Überlegenheit des 18-Jährigen gegenüber Jüngeren abgeleitet. Ein
Altersunterschied ist kein Qualitätsunterschied, der Überlegenheitsdenken
rechtfertigt. Im Gegenteil: Die von uns geschilderten Systemdaten des
18-Jährigen weisen auch gewaltige Evolutionsmängel für sein Stadium auf,
die keineswegs immer bei der Entwicklung einer Menschheit auf einem Planeten in
den Stadien II. HLA, 2 und II. HLA, 3 notwendige Durchgangsstadien bilden
müssen. Der Vergleich der Systemdaten mit den Zuständen einer reifen Menschheit
im III. HLA zeigt vielmehr, in welchem Ausmaß das System der Industriestaaten
schwere Entwicklungsmängel aufweist. Und gerade dieses System soll den jüngeren
Geschwistern als Vorbild dienen können?
Im System der
Industriestaaten begegnet man heute dem Gedanken, dass dieses zwar noch nicht
die Menschheit repräsentiere, aber universeller eingestellt sei als Territorial-
oder Nationalstaaten. Dem Zivilisationsmodell wird daher bereits ein sehr hoher
Grad an Universalität zugesprochen, der ihm aber offensichtlich bei Beachtung
der Dominanzstrukturen im Weltsystem keineswegs zukommt.
Varianten:
* Die
Menschheit entwickelt sich unter allmählicher Einführung der Prinzipien des
Urbildes derart weiter, dass alle drei Systemtypen sich allmählich in der neuen
Struktur integrieren und ausgleichen. Es ist dies die optimale
"(or-om)-menschheitszentrierte" Möglichkeit der globalen Integration.
Es kommt
allmählich zur Bildung kontinentaler Staatenbünde oder Bundesstaaten
(Völkervereine), ohne dass die maximale Individualität der Einzelstaaten (S1, S2
usw.) aufgehoben würde. Schließlich integrieren sich diese Bundesstaaten oder
Staatenbünde in einem Weltstaat, der Teil des Menschheitsbundes gemäß der
umseitigen Grafik ist.
Diese
Variante erscheint derzeit, im Jahre 2003, nicht sehr realistisch, weil noch
viel zu wenige Wissenschafter und Politiker diese Ideen als Evolutionsparameter
anerkennen und umzusetzen gedenken und weil auch das strikte Gebot der
friedlichen Umsetzung dieser Ideen derzeit abwegig erscheint. Dieser Weg der
Entwicklung könnte aber nach der kritischen Erschöpfung der im folgenden
geschilderten Varianten sehr wohl bessere Möglichkeiten vorfinden.
* Die anderen
Systeme, we2 und we3, destabilisieren das überlegene, westliche
(nach manches Ansicht bereits im Abstieg befindliche) System und erzwingen einen
Ausgleich, wobei sie in der Lage sind, die westlichen Systemwerte überwiegend zu
übernehmen. Es entsteht ein System mit westlichen Werten, wobei Halbperipherie
und Peripherie mit dem Zentrum verschmelzen.
* Im Kampf
der Systeme obsiegt ein anderes, neues Zentrum, welches in einer dem
derzeitigen westlichen System vergleichbaren Weise die schwächeren anderen
Systeme wirtschaftlich, technisch und militärisch beherrscht und imperial
dominiert.
* Es kommt zu
pluralen Entwicklungssträngen. Der derzeitige, über wirtschaftliche, technische
und militärische Dominanz erzwungene Zusammenhang zwischen dem Zentrum und den
anderen Systemen wird gelöst, mehrere voneinander unabhängige Systeme leben
relativ getrennt, jedenfalls nicht in hierarchischen Abhängigkeiten
nebeneinander. Eine weitere Integration in eine globale Weltgesellschaft erfolgt
nicht. Diese Variante von Abkoppelungsmodellen erscheint ebenfalls nicht
sehr realitätsbezogen, da die Verflechtungen und Abhängigkeiten im Weltsystem
schon viel zu weit fortgeschritten sind.
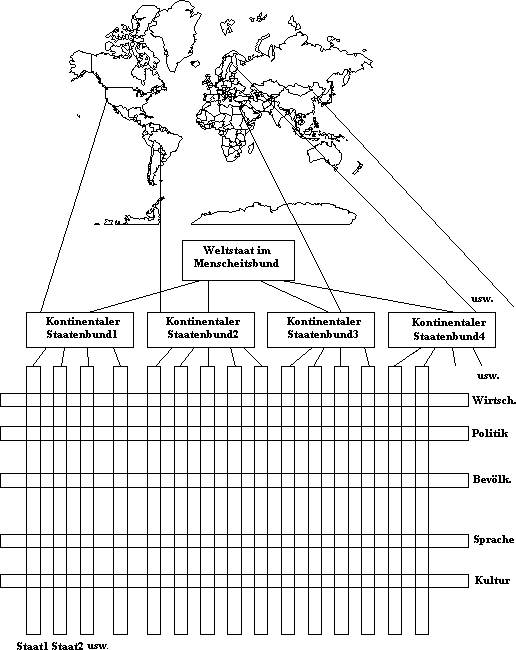
"Mich
befriedigt es, dass weite Teile der modernen Literatur gerade aus dieser
quälenden Spannung erwachsen sind: ein Europäer zu sein und gleichzeitig davor
eine große Abscheu zu haben."
(Orhan
Pamuk)
Wenn wir für
diese beiden Systemtypen – wie oben für die Industrieländer des Zentrums – die
Einordnung in die Entwicklungszykloide durchführen und den Evolutionsmaßstab des
Urbildes benutzen, ergibt sich, dass die peripheren und halbperipheren
Ländergruppen (bildlich als 15-Jährige bezeichnet) sich überwie-gend in den
Phasen II. HLA, 1 und II. HLA, 2 sowie in den Überschneidungen a und b befinden.
Wir haben hier nicht die Absicht, eine umfassende Analyse aller derzeit realen
Variationen der Systemtypen durchzuführen. Wir müssen uns auf einige wichtige
Grundparameter beschränken, ohne auf die hohe Vielfalt der Modellunterschiede,
etwa zwischen China und Marokko, eingehen zu können. Schon das vorne für das
Sozialsystem2 entwickelte Modell zeigt die entscheidenden Unterschiede zu
einem Industrieland.
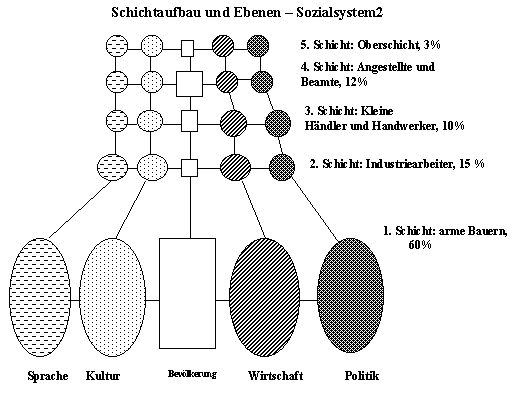
Grundmuster
ist die seit dem Eingriff der dominierenden Mächte des Zentrums entstandene
Spaltung aller Identitätsstrukturen, aller Ebenen, Schichten und Personen im
Spannungsfeld zwischen Elementen der Tradition (lila) und den jeweils über
Dominanz und Unterdrückung repräsentierten grünen "westlichen" Werten,
Institutionen und Strukturen der "Moderne" (des westlichen Kulturuniversalismus
in Figur 5). Man spricht von Rissen und Verwerfungen, die sich in der
Kontaktzone einer historischen Transmission herausbilden. Sie wird etwa als
Schnittstelle zwischen moderner Subjektivität und historischem Bewusstsein
definiert, "die aus ungleichgewichtigen, häufig gewalttätigen Konfrontationen
entstehen und Muster aussagekräftiger Normen des kulturellen Erbes und
Austausches, der Differenz und oppositioneller Strategien, welche die Integrität
nichtdominanter Kulturen zu erhalten suchen, bilden" (Enwezor).
In der Regel
ist dies verbunden mit Traumen, dem Empfinden von Wehrlosigkeit, blindem Hass,
der sich in unwirksamen Revolten äußert oder mit ambivalenter Hassliebe, mit
einem Gefühl der Minderwertigkeit, das durch die unterschiedlichsten Strategien
der Rückverstärkung traditioneller Wertsysteme und Institutionalisierungen
ausgeglichen werden soll. Ein politisch, wirtschaftlich, technisch,
institutionell gefärbtes Gefühl der wehrlosen Unterlegenheit trifft auf die
ständigen Demütigungen kolonialer und postkolonialer Intervention des Westens
und führt zu oft brutalen, anarchischen und gewaltgeladenen
Gegenmodellen.[16] Die
leidvolle Geschichte dieses ständigen Identitätskonfliktes wird selbst Teil der
Subjektivität der Marginalisierten.
Auf allen
Ebenen (1.1 – 1.4 der umseitigen Gliederung) wird der Identifikationskonflikt
zwischen den grünen Werten des Westens, die von außen in Form realen
existenziellen Druckes erschienen, und den eigenen Traditionen bisweilen über
Jahrhunderte in schwankenden Veränderungen lebendig erhalten.
1.1 Religion – Kultur – Technologie – Wissenschaft – Kunst
1.2 Sprache – Kommunikation – Medien
1.3 Wirtschaft
1.4 Politik – Recht (Verfassung, Verwaltung, Gerichtsbarkeit) – Ethik
Oft erfolgt
die Auflehnung gegen die Dominanz gerade unter Einsetzung der verachteten
westlichen Errungenschaften. Erst wenn sich die Entwicklungstheorie diesem
komplexen Schema der Figur 5 öffnet, kann sie die Differenz zwischen Zentrum und
Identitätsproblemen der Peripherien pragmatisch kompetent bearbeiten. Wir sehen
etwa in der Theorie der Hybridität[17] einen
Ansatz, mit diesem Problem umzugehen. Es geht um ein Verstehen der
"Ambivalenz und des Antagonismus, die dem Begehren des Anderen
innewohnen". Der Entwurf eines solchen Kulturbegriffs wirft unweigerlich Fragen
der kulturellen Selbstkonstruktion, einer kulturellen reaktiven Re-Definition,
der Grenzüberschreitung und der multiplen Identitäten auf.
Die
Eindeutigkeit sozialer, kultureller, politischer und geografischer Grenzen wird
verwirrt. Kultur wäre demnach immer eine Kultur des Vermischens, welches
Unreinheit, Unschärfe und Interferenz produziert. Kulturelle Synkretisierung,
Fragmentierung, Karnevalisierung und Kreolisierung sind weitere Hilfsbegriffe
dieses Zusammenhangs. Bedenken wir hier auch, dass die postkoloniale Theorie als
Gegnerin des westlichen Gestus der humanistisch-idealistischen Aufklärung
folgendes anstrebt: 1. für das nicht-westliche Wissen epistemologischen
Stellenwert zu reklamieren, d. h. Wissen, das durch den modernen Imperialismus
mit Gewalt universalisiert wurde, zu reprovinzialisieren, 2. die
Vorstellung von Homogenität, Vorherrschaft und Dominanz aufgeklärter
Wissenssysteme zurückzuweisen und kulturelle Differenzen, die durch Humanismus,
Aufklärung, Idealismus und Marxismus aufgehoben wurden, wieder herzustellen.
Kritisch ist
jedoch hier anzumerken, dass der Ansatz der Hybridität, selbst ein Kind der
Postmoderne, seine Theorie nicht wieder auf sich selbst anwendet und daher
letztlich totalisierend und einheitsstiftend ist: als die Einheit der multiplen,
diffusen Unsicherheiten, Ambivalenzen und Vermischungen. Über begrenzte
Evolutionsschritte kann mit diesem Theorem nicht hinausgelangt werden.
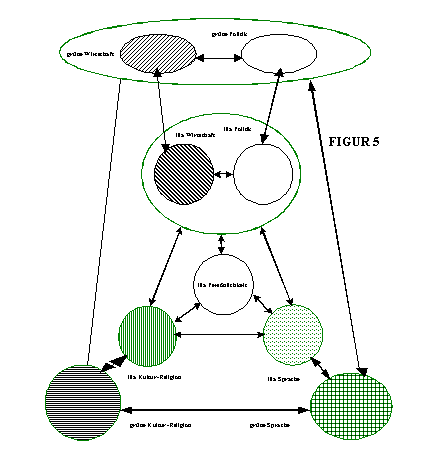
Identitäten
jenseits der postkolonialen Hybridität sind möglich. Sicherlich aber nicht
innerhalb der Paradigmen der westlichen Dominanzideologie sondern erst in den
Prinzipien der von uns angedeuteten neuen Evolutionsstufe.
Wir haben das
Element der Autorität, dessen Auflösung in Differenzierungen und die
Universal-Integration in der höchsten Evolutionsphase im Kapitel über die
Entwicklungsgesetze als ein Grundkriterium aller inhaltlichen Elemente
der Gesellschaftlichkeit dargestellt. Während in der Geschichte der
Industriestaaten zwar auch endogene und exogene Faktoren die Differenzierungen
in allen Parametern vorantrieben, ist die Evolution in den Entwicklungsländern,
wie wir zeigen, erheblich komplexer, da sie nicht nur eine homogene
Ausgangssituation differenzieren, sondern ihnen eine "verdoppelt-gespaltene"
aufgezwungen wurde und wird. Die inhaltliche Inkompatibilität zwischen den
(lila) Ausgangswerten und den "überlegenen" grünen erzeugt die schwierigsten
Konflikte in den Evolutionsinhalten und Differenzierungen, was zu gewaltigen
Schwankungen, Variationen, Diskontinuitäten, Überschneidungen und Ambivalenzen
in den Entwicklungszielen und -richtungen führt. Die LeserInnen mögen sich dies
etwa am Kontrast zwischen dem Volk der Alindu und dem Sozialsystem1 in
Figur 2 vergegenwärtigen.
Mit
Sicherheit muss man hier, wo wir autoritäre Strukturen analysieren, deutlich
festhalten, dass die ökonomisch-strategische Dominanz des Zentrums selbst eine
Art autoritärer Struktur darstellt, die ihrerseits grundsätzlich zu
überwinden ist, um eine global ausgewogenere Entwicklung aller Systeme zu
erlauben. Dies kann nur durch den Übergang in das III. HLA erreicht werden.
"Der
postkoloniale Staat in Afrika kann weder mit den Kategorien der Klasse noch der
Ethnizität erklärt werden." (Peter Molt)
Die
LeserInnen mögen die vorne dargestellte Weltsystemdebatte und vor allem die
strategische Umklammerung mitdenken, in welcher sich diese Systeme durch das
Zentrum befinden.
Grundsätzlich
ist zu bedenken, dass sich heute ständig neue Staaten unter verschiedensten
Bedingungen bilden (Staaten auf dem Balkan, in Mitteleuropa, im Baltikum, in
Osteuropa, im Kaukasus, in Zentralasien, in Ostafrika) und noch weitere in
Fragmentierungsprozessen bilden werden. Die Staatenbildung auf dem Balkan ist
ein typischer Übergang aus der Autorität des II. HLA, 1 in die Selbständigkeit
des II. HLA, 2; es zeichnen sich auch bereits Trends zur Integration in die EU
als Übergang in Phase II. HLA, 3 ab. Bestimmte Völker wie die Roma, die Kurden
und die Palästinenser werden in den nächsten Entwicklungsstufen ihren Staat
erhalten.
Wir
wollen zwar für die Analyse politischer Gesichtspunkte die Skizze über
Schichtaufbau und Ebenen im Sozialsystem2 benutzen, unsere obigen
Ausführungen über die ethnozentrischen Brillen müssen uns aber zur Vorsicht
mahnen. In vielen Entwicklungsländern ist gerade ein Schichtaufbau im Sinne
westlicher Staaten keineswegs klar ausgebildet. Die durch Arbeitsteilung, Macht-
und Ressourcenverteilung bestimmte Gliederung ist völlig diffus mit
vorkolonialen Stammes- und Clanmechanismen der Arbeitsteilung und -zuteilung
bzw. entsprechenden Ressourcenverteilungen gemischt. Die Begriffe Schicht (grün)
und Stamm (lila) durchdringen einander in einer theoretisch kaum fassbaren
Weise. Gerade dies kann unsere Figur 5 sehr deutlich demonstrieren. Die beiden
Begriffe sind inhaltlich inkompatibel. Ähnliches gilt in Indien für das
Kastenwesen. Dieses Beispiel führt zu folgendem allgemeineren
Grundsatz:
Beim Versuch
einer Beschreibung der Komplexität der Realität in den Systemtypen we2
und we3 stoßen wir auf eine bestimmte Unbrauchbarkeit der eigenen
traditionellen Begriffe des Systems wie auch der aus dem westlichen System
stammenden sozialen und politischen Begriffe. Schließlich sind wir mit der
inhaltlichen Inkompatibilität der alten und neuen Begriffe konfrontiert.
In der Analyse bildeten sich daher unterschiedliche Positionen aus, die entweder
mehr mit den lila Brillen oder mit den grünen Brillen ein System betrachten, das
eigentlich bereits weder lila noch grün ist. Bedeutungsvoll ist dies auch
deshalb, weil diese unterschiedlichen Analysen auch im System in einander
oft bekämpfende, politische und ökonomische Handlungsstrategien umgesetzt werden
und einschneidende reale Folgen im System besitzen können.
Unter diesen
Vorbehalten sind die folgenden Verallgemeinerungen zu lesen.
Bei der
Untersuchung des Systems ist primär nach den Eliten und den ihnen
zugeordneten Oberschichten (Militär, Polizei, Geheimdienste, Beamtenschaft usw.)
zu suchen. Diese herrschen in der Regel deutlich autoritär, wobei die
Legitimationsideologie oft noch religiös oder quasi-religiös (z. B. marxistisch)
fundiert wird. Die Bildung dieser Eliten geht häufig auf koloniale Traditionen
zurück. Auch heute stehen die Kolonien noch häufig mit der ehemaligen
Kolonialmacht in Verbindung. Bestimmte "westliche Modernisierungsschübe" wurden
in Nicht-Kolonien häufig durch militärische Führer eingeleitet, die wiederum
autoritäre ältere Herrschaftsmodelle zerschlugen und die herrschenden Eliten
eliminierten (Türkei, China).
Die
Integration "vormoderner" sozialer Einheiten, wie z. B. Stämme, Clans und
Stammesverbindungen, in einem Nationalstaat westlicher oder anderer
Prägung, erweist sich in einer fast unübersehbar unterschiedlichen Weise als
kompliziert
(z. B. Schwarzafrika, irakische Diktatur, Integration der
kurdischen Stämme im Iran, in der Türkei und im Irak, Berberstämme in Marokko
usw.). Häufig wurde von den Kolonialmächten die Stammesstruktur erhalten oder
ausgebaut. Wo sie auf vorkoloniale Staaten stießen, schwächten Kolonisatoren die
politische Zentralmacht des Herrschers durch direkte Unterstellung der Stämme
unter die koloniale Administration.
Der Kampf
gegen den "Tribalismus", d.h. gegen die politische Nutzung ethnischer Identität,
wurde durch die postkolonialen, modernen, westlich gebildeten Eliten mittels der
Idee der Nation (Volkssouveränität, freie Wahlen, parlamentarische
Kontrolle) als Entwicklungsidee vorangetrieben. Damit wollte man die armen
ungebildeten Bauern und die verarmte städtische Bevölkerung, die weiter in
traditionellen Mustern lebten, zur Modernität erziehen. Man nahm an, die
nationale Einheit sei Voraussetzung für die moderne Entwicklung. Die nach der
Erreichung der Unabhängigkeit bei der neuen Verteilung der Macht unterlegenen
Eliten und traditionellen Führer aktivierten für eine Rückgewinnung von
Einfluss die Stammessolidaritäten in den intraelitären Machtkämpfen. Der Bildung
eines übergreifenden Nationalbewusstseins war häufig abträglich, dass die
herrschenden Eliten die demokratischen Prinzipien nicht realisierten, sondern
ihre einmal errungene Macht nicht mehr abgeben wollten und durch Pfründe und
Privilegien verschiedene Segmente der Eliten an sich binden oder gegeneinander
ausspielen konnten (Korruption, Bevorzugung der Verwandtschaft, der Region,
Klientel oder Ethnie). Es entwickelten sich häufig autoritäre
Einparteienstaaten mit Personenkult. Diese Mechanismen führten
auch zu ökonomischen Konsequenzen bei der Verteilung der modernen, lukrativen
Arbeitsplätze bei zunehmenden Landmangel. Auch in weitere
Demokratisierungsprozesse spielt diese Konstellation hinein. Die entmachteten
alten Eliten und ausgeschlossenen Gruppierungen führen oft harte Kämpfe, gegen
die herrschenden Eliten, die sich mit aller Gewalt an der Macht halten wollen.
Nach Bayart ist etwa der Staat in Afrika kein integraler Staat. Ethnische
Gruppen bleiben strategische Gruppen, die ihren Mitgliedern Zugriff auf
Einkommen und Ressourcen, unter Umständen auch rechtlichen, polizeilichen und
militärischen Schutz, vermitteln können. "In einer gewissen Weise dienen
ethnische Klientelnetze dazu, eine Reziprozität zwischen Führer und Mitglied
der ethnischen Gruppe zu bewirken, die in der Beziehung zwischen
Bürger[18] und Staat im
postkolonialen Staat nicht begründet wurde" (Molt).
Diesen
heiklen Transformationsprozessen entsprechend hat die Armee in der Regel
in diesen Ländern eine entscheidende Funktion. Sie wird häufig im Übergang als
"Schule der Nation" betrachtet. Offiziere und Mannschaften werden zur Loyalität
zum neuen Staat und zur "Nation" erzogen und aus den tribalen, regionalen und
ethnischen Bindungen herausgelöst. Die militärische Führungselite bildet neben
den zivilen Eliten eine eigene funktionelle, "überparteiliche" Einheit, die bei
politischen Labilisierungen durch Interventionen (unter Sistierung
demokratischer Verfassungen) die nationale Einheit zu erhalten sucht. Häufig
entwickelt die Armee sich jedoch zu einer autonomen politischen Kraft weiter und
schafft sich eigene Rechtfertigungs- und Herrschaftsideologien (wie Kampf gegen
Imperialismus und Neokolonialismus oder um die nationale Befreiung und Einheit
oder gegen Regionalismus und Tribalismus oder um die "ethnische" Identität
usw.). Auch hier entwickeln sich aber durch Willkür, Parteilichkeit, Korruption
und den Konflikt rivalisierender Offizierscliquen Verfallserscheinungen, die bis
zur Ethnisierung der Ordnungsmacht führen können und eine Diskreditierung der
Armee zur Folge haben.
Auch bei der Analyse der wirtschaftlichen Zusammenhänge und Charakteristika ist es unerlässlich, unser Schichtmodell zu berücksichtigen, auch wenn wir sahen, dass die Begriffe "Schicht" und "Stamm" beide nicht eindeutig zur Darstellung geeignet sind. Sicher ist jedoch, dass in den Entwicklungsländern die politisch autoritär agierenden Oberschichteliten und die von ihnen durchsetzte und kontrollierte Administration einen entscheidenden Einfluss auf die Wirtschaftsgestaltung ausüben. Wenn wir uns die oben geschilderten Strategien dieser Eliten vergegenwärtigen (endogene Faktoren) und sie mit dem gewaltigen Druck verbinden, der von den Industriestaaten auf diese Länder ausgeübt wird (exogene Faktoren), dann zeigt sich, dass die meisten Entwicklungstheorien, die bisher entwickelt wurden, eher immer nur Segmente des komplexen Gefüges berücksichtigen.
Die eurozentrierte Modernisierungstheorie betont die endogenen Faktoren. Sie geht vor allem von der These aus, traditionsverhaftete, hierarchisch autoritäre Gesellschaftsformen erschwerten von innen heraus den Wandel. Sie fordert Nachahmung, Angleichung und Übernahme technischer, wirtschaftlicher, sozialer und zivilisatorischer Errungenschaften des Westens. Die hierbei erfolgende Zerstörung der alten Wirtschaftordnungen in den Peripherien, vor allem im Rahmen der Globalisierung, wird zynisch als "kreativer Wandel" umschrieben. Die Aufholstrategien, welche man den Entwicklungsländern nahe legt, befürworten entweder Bildung von Entwicklungspolen mit Ausstrahlung auf andere Bereiche oder die Strategie des Balanced Growth, bei welcher der Agrarsektor speziell gefördert werden sollte. Das Stufen-Modell Rostows schließlich geht naiv davon aus, dass in den Entwicklungsländern stufenweise eine Entwicklung nachvollzogen wird, wie sie in den Industrieländern ablief. Alle diese Theorien berücksichtigen viel zu wenig, dass in den Systemtypen we2 und we3 die Uhren eben anders gehen und vor allem, dass die Dominanz des Zentrums eine Veränderung des Uhrenlaufs eher schwerstens behindert oder wie in den Rohstoffländern diese in asymmetrisch einseitige Richtung hin verbogen hat.
Imperialismus- und Dependenztheorie betonen wiederum die exogenen Faktoren (koloniales Erbe und weiter fortgesetzte Ausbeutung, "Raub" der Bodenschätze, Kapitaltransfer von Multis aus den Entwicklungsländern, Protektionismus des Zentrums, schlechte Weltmarkteinbindung, Verschlechterung der Terms of Trade und internationale Arbeitsteilung als strukturelle Abhängigkeit). Teilweise kam es im Rahmen einer Ideologisierung dieser Theorien zu einer autoritär kommunistischen Herrschaftsform in einigen Ländern der Peripherie. Auch unter diesen Regimen kam es zu einer dualistischen Wirtschaftsweise ohne Fortschritte im traditionellen Sektor, zu wachsenden regionalen Disparitäten, zu versteckter Armut und Arbeitslosigkeit, zu starker Unterdrückung von Minderheiten und Dissidenten. In diesen Theorien erfolgt eine Ausblendung der endogenen Faktoren. Zugehörige Entwicklungsstrategien sind etwa: Grundbedürfnisstrategie, angepasste Entwicklung, neue Weltwirtschaftordnung im Rahmen der wenig effizienten UNCTAD, Abkoppelung vom Weltmarkt und autozentrierte Entwicklung oder eine Doppelstrategie mit bilateralem Dialog und multilateralen Konfrontationsstrategien.
Theorien, welche eine Synthese der endogenen und exogenen Faktoren und deren durch Asymmetrien gekennzeichnete Wechselwirkung und Mischung heranziehen, sind sicherlich aussagekräftiger. Hier geht man auch von einer synchronen Entwicklung in gegenseitiger, wenn auch "schiefer" Abhängigkeit aus. Eine spezifische Analyse des einzelnen Landes und seiner Faktoren ist unerlässlich. Die Parameter für eine positive Veränderung dieser Entwicklungshorizonte sind derzeit nicht zu sehen, die Entwicklung der Peripherien erscheint hauptsächlich als abhängige oder Reflexwirkung, da das Zentrum, wie wir zeigten, den Lauf der Dinge wirtschaftlich plant, koordiniert und entscheidet.
Für die
Steuerung und Manipulation politischer, wirtschaftlicher, kultureller (darin
religiöser) Prozesse ist es unerlässlich, eine Unterscheidung zu beachten, die
sich auf die Art bezieht, wie Kommunikation in einer Gesellschaft
erfolgt. In den Ländern der Peripherie finden wir noch große Anteile an
Analphabetentum. Wir müssen beachten, dass Menschen, die in einer oralen
Kultur leben, ganz spezifische psychische Strukturen und Bewusstseinsformen
besitzen, da sie Wissen, gesellschaftliche Identitäten und Möglichkeiten ihrer
Veränderung nur durch den Gehörsinn, also in direktem Kontakt mit
anderen, erhalten können.[19] Mc Luhan
betonte bereits, dass orale Kulturen daher autoritäre Strukturen
begünstigen, was sich schon aus der kommunikativen Grundsituation ergibt. Für
die Heere der armen Landbevölkerung und der Slumbewohner in den Städten bedeutet
aber eine Alphabetisierung und damit der Einfluss der Schriftkultur, der
bekanntlich das Schwergewicht auf den Gesichtsinn verlegt, nur wenig. In
der Regel bleibt ihr Bildungsniveau gering und die Bewussteinsveränderung und
der "emanzipatorische Effekt" durch den Eintritt in die Schriftkultur treten
nicht ein. Die in den Zentren seit langem erfolgte Umstellung großer
Bevölkerungsschichten in die Bewusstseinslagen der Schriftkultur ist in den
Peripherien für die niederen Schichten nicht eingetreten. Sie vollziehen
vielmehr gleichsam einen Sprung aus der oralen Kultur direkt in
die elektronischen Medienbedingungen. Die elektronischen Medien lösen
bekanntlich integrative Effekte aus. Die in der Schriftkultur
differenzierten und emanzipierten Bewusstseinsstrukturen werden in
synthetisierende umgewandelt. Diese Veränderung erhöht jedoch weder die Bildung
noch begünstigt sie die Aufstiegschancen dieser armen Schichten. Die Eliten
benutzen die Rundfunk- und Fernsehmonopole eben dafür, die im Fond der oralen
Kultur lebenden armen Massen zu manipulieren.
Für die
Überwindung großfamiliärer und tribaler Sozialstrukturen, die mit lokalen
Sprachtraditionen[20] verbunden
sein können, in Richtung auf einen nationalen Einheitsstaat, bildet der Versuch
der Durchsetzung einer zentralen Sprache einen wichtigen Beitrag.
Auch bei
gröbsten Schematisierungen sind hier nur Andeutungen möglich.
Die Art der
religiösen Modelle in den Peripherien ist komplex. Resttraditionen
sakralen Königtums (Verbindung spiritueller und politischer Macht über ein Volk,
wie wir es vorne für das Volk der Alindu andeuteten), Heilkulte, Regionalkulte,
ethnische Religionen (indianische, arktische und Religionen der australischen
Ureinwohner), Weltreligionen (chinesische Religionen, protestantisches,
katholisches und orthodoxes Christentum, schiitischer und sunnitischer Islam,
Hinduismus, Judentum, Therevada-, Mahayana- und tibetischer Buddhismus mit den
vielfältigsten synkretistischen Verbindungen mit älteren lokalen Varianten und
zahllosen Sekten ) sind in den einzelnen Ländern nach der Stellung der Eliten,
der ethnischen Streuung, nach Stadt- und Landbevölkerung, die häufig kaum
alphabetisiert, sich um spirituelle Führer schart, verteilt.
In fast allen
Religionen sind neben den sozial etablierten Varianten esoterische
Geheimtraditionen lebendig, die für die weitere Entwicklung der Menschheit
deshalb entscheidende Bedeutung besitzen, weil die Menschheit sie alle im Rahmen
ihrer Integration zentral zu sammeln und zu vergleichen haben wird. Fruchtbar
wird es sein, alle diese tiefen Traditionen, deren Kenntnis auch den
gegenseitigen Respekt der Systeme erhöhen wird, mit dem Urbild der Religion in
der Wesenlehre in Verbindung zu bringen.
Einzelne
Bewegungen besitzen globale Reichweiten (Sufi-Orden, Cao Dai, Sokka Gakkai
International). In den Peripherien des Südens bilden sich nicht nur islamische
Bewegungen gegen den Norden, sondern auch christliche Strömungen, wie
etwa die nigerianische Celestial Church of Christ, mit Verbindungen zu
afrikanischen Traditionen (unabhängige afrikanisch-christliche Kirchen). Vor
allem den Zuwanderern in den rasch wachsenden Slums der Metropolen des Südens
werden derartige Organisationen Überlebensgemeinschaften. Religionen bieten sich
am freien Markt der Glaubensrichtungen an und bilden ein Wirtschaftssystem der
"Religious Economy". Die Spiritualität des Südens beginnt sich nicht nur im
Islam gegen den säkularen Norden zu richten.
Die Aspekte,
in denen Religionspraxis instrumentalisierend für politische Ziele eingesetzt
wird, sind in den Ländern des Zentrums und der Peripherien und in ihrer
Wechselwirkung unübersehbar. Religiöse Werte dienen Befreiungsbewegungen,
fungieren bei der Nationenbildung gegen ethnische oder tribale Vielfalt, in
Widerstandsbewegungen gegen westliche Dominanz oder die Unterdrückung durch
Religionen einer Mehrheit. Genannt seien etwa: Hinduismus bei der
Nationalwerdung Indiens, Christentum als Vehikel des Kolonialismus, muslimische
Orden als ideologisches Mittel zur Einigung kurdischer Stämme oder als Spitze
von Befreiungsbewegungen, politisch aufgeladener Konflikt zwischen Aleviten
(links) und Sunniten (rechts) in der Türkei. In den späten 90er-Jahren gab es
etwa folgende religiös-ideologisch besetzte Bürgerkriege und regionale
Auseinandersetzungen: Bosnien, Irak, Sri Lanka, Algerien, Israel, Armenien,
Aserbeidschan, Myanmar, südlicher Sudan, Kaschmir, Philippinen, Osttimor,
Nordirland, Tschetschenien und Abchasien, Kaukasusregion, Teile Russlands, Tibet
und Nigeria.
In der
Diskussion der Stellung aller Religionen im Zusammenhang einer globalen
Menschheit, einer Kritik der eurozentristischen Philosophietradition und der
Forderung nach einer Gleichrangigkeit religiös fundierter Philosophietraditionen
aller anderen Völker versucht die Strömung der interkulturellen
Philosophie eine dialogische Integration und Minderung des westlichen
Dominanzverhaltens.[21]
Habermas hat
bekanntlich eine Evolution der Rechtfertigungsniveaus von Herrschaftslegitimität
nach folgendem Schema entwickelt:
Frühe
Hochkulturen:
Rechtfertigung mittels Ursprungsmythen.
Imperiale
Hochkulturen:
Kosmologisch begründete Ethiken, Hochreligionen und Philosophien, die auf die
großen Stifter Konfuzius, Buddha, Sokrates auf die israelischen Propheten und
Jesus zurückgehen. Diese rationalisierten Weltbilder haben die Form
dogmatisierbaren Wissens, auf dieser Stufe steht auch die ontologische
Denktradition.
Neuzeit: Infolge der
Problematisierung einer metaphysischen Letztbegründung tritt in der
Rechtfertigung von Normen und Handlungen an die Stelle inhaltlicher
Prinzipien, wie Gott oder Natur, das formale Prinzip der Vernunft.
Die Prozeduren und Voraussetzungen vernünftiger Einigung (kommunikative
Vernunft) werden selbst zum Prinzip.
Die aus
religiösen Bindungen in die Bereiche einer Vielzahl von Vernunftkonzepten
auseinander tretenden Legitimationsniveaus politischer Herrschaft westlicher
Prägung nehmen natürlich an, dass sie selbst das höchstmögliche Evolutionsniveau
von Legitimität seien, und blicken daher auf das durch Entwertungsschübe
eigentlich obsolete Treiben der "weniger entwickelten" Peripherien herab. Diese
wiederum kritisieren die säkularen Strukturen des Zentrums, dessen strukturell
autoritäre Dominanz mit ihrer Demütigung einhergeht.[22]
Hier sei auf
den obigen Aufriss über die Hybridität verwiesen. Es kommt zu den bekannten
synkretistisch-hybriden Mischungen, Ambivalenzen, Spannungen, Widersprüchen und
Synthesen zwischen westlichen Kultur-, Wissenschafts- und Kunstelementen und
traditionell-heimischen, deren Vielfalt und Schwankung in jedem einzelnen Land
für die politischen, wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und künstlerischen
Eliten wie deren Opponenten, die Administration, die Industriearbeiterschaft und
die marginalisierten Stadt- und Landschichten, zu untersuchen ist. Diese
Prozesse sind wiederum alle unter Berücksichtigung von Figur 4 durch Einbettung
in die Hierarchie des Weltsystems zu bewerten.
Für die Analyse jedes von we1 verschiedenen Systems ist es unerlässlich, die oft völlig anderen Familienstrukturen und deren Übergangsformen genau zu beachten. Während in den Staaten des Zentrums die atomisierte Kleinfamilie vorherrscht, bisweilen sogar selbst zerfällt und sich in neuen Patchwork-Familien lose sammelt, finden sich in den anderen Systemtypen häufig Modelle von Großfamilien, Clans und Stämmen, die eine mehr oder weniger strenge sprachlich-kulturell-wirtschaftliche Einheit bilden, in denen die einzelnen Mitglieder durch rigide Rechte und Pflichten in traditionell bestimmten Positionen funktionell miteinander verbunden sind. Hier können die Typologien nicht ausgeführt werden. Das vorne geschilderte Volk der Alindu ist ein Beispiel für sogar in kosmische Relationen eingebundene Familienbeziehungen. Wenigstens einen weiteren Typ wollen wir den LeserInnen als Gedankenstütze vorlegen:
|
Vater – Mutter ╤ | |||
|
1. Sohn – Frau 6 Kinder Feldbestellung |
2. Sohn – Frau 5 Kinder Speisenbereitung, Brennstoff |
3. Sohn – Frau 6 Kinder Tierzucht, Hirten |
4. Sohn – Frau 4 Kinder Verkauf der Produkte in der Stadt |
Alle 31 Personen leben in einem Haus, jede Familie bewohnt ein Zimmer für sich, wobei wieder eine Trennung zwischen Eltern und Kindern erfolgt. Die oberste Autoritätsperson ist der Vater. Die nächstfolgende ist der älteste Sohn. Im Falle des Todes des Vaters wird der älteste Sohn automatisch das Oberhaupt der Großfamilie.
In unserem Falle hat der noch lebende Vater dem ältesten Sohn die Verwaltungshoheit übertragen – er handelt im Namen des Vaters und ist die höchste Autorität in den die gesamte Großfamilie betreffenden ökonomisch-sozialen Fragen. Gleichzeitig ist er in seiner eigenen Familie die höchste Autorität. Die übrigen Söhne, selbst die Häupter ihrer Familien, stehen ihm untergeordnet, also eine Stufe unter ihm; nur in den Beziehungen untereinander besteht zwischen den Söhnen 2 – 4 eine Hierarchie.
Sollen Entschlüsse gefasst werden, spricht der älteste Sohn mit den drei anderen Söhnen. Wichtig ist auch, dass der 1. Sohn beispielsweise den Kindern des 4. Sohnes nicht direkt Anweisungen gibt, sondern diese erhält stets der Vater der Kinder. Nur wenn die Angelegenheit bereits mit dem 4. Sohn besprochen wurde, erfolgt eine direkte Weisung an dessen Kinder. Für die Kinder des 4. Sohnes ist die unmittelbare Autoritätsperson stets der Vater, das Kind merkt aber, dass es über dem eigenen Vater stärkere Autoritäten gibt, von deren Wort der Vater selbst wieder abhängt. Es sind dies in unserem Fall besonders der älteste Onkel, in geringerem Maße die nächstjüngeren Onkel. Treten Streitigkeiten zwischen den 4 Söhnen auf, so schlichtet sie der Vater. Die Willensbildung erfolgt nach Anhörung der Betroffenen. Das Wort des Hauptes, das entscheidet, gilt dann jedoch ohne weitere Debatte. Wenn ein Mitglied mit der Entscheidung nicht einverstanden ist, kann es den Verband der Großfamilie verlassen, wenn es sich nicht fügt, muss es ihn verlassen. Die Einkünfte werden beim ältesten Sohn gesammelt, der sie aliquot auf die gesamte Familie aufteilt, in diesem Falle also vierteilt. Im obigen Fall bestehen familiäre Arbeitsteilung und gemeinsamer Haushalt. Hätte die erste Generation auch eine Tochter, so würde diese im Falle der Eheschließung aus dem Familienverband ausscheiden und in die Familie ihres Ehemannes überwechseln. Bei traditioneller Cousinheirat wird das Ausscheiden vermieden.
Dieses Modell wird im Laufe der Auflösung der Hausgemeinschaft, etwa durch Übersiedeln eines Teils der Familie in die Stadt, in gelockerter Form oft noch lange fortgesetzt. Die kollektiven Solidaritätsverpflichtungen, das Verantwortungsgefühl, Heiratspräferenzen (etwa zwischen Geschwisterkindern oder nur im Rahmen der gleichen Religionsgemeinschaft) werden weiterhin aufrecht erhalten. Auf die von den westlichen Systemen oft völlig unterschiedlichen psychischen Strukturen, Individuationsgrade, Autoritätsbindungen und -hierarchien, Kollektividentitäten sei besonders hingewiesen.
Auch hier spielen die Übergangs- und Auflösungsformen im "Modernisierungsprozess" eine beachtliche Rolle. Zu beachten bleibt jedoch, dass die Schwäche der Sozialstaatlichkeit in den Ländern der Peripherien eine völlige Lösung dieser autoritären Bindungen nicht ermöglicht, sondern dass im Gegenteil, wie wir zeigten, Nepotismus, Tribalismus und sonstige Phänomene der Verwandtenbegünstigung institutionelle Mischungen mit "westlichen" Organisationsformen eingehen.
Wir wollen zunächst gleichsam einen Grundplan zeichnen )(Näheres unter (Pf 03).
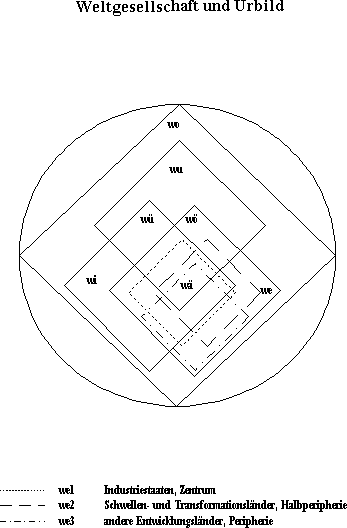
Aus der Frage, ob die Sozialformen in we1 durch Übernahme aller oder einzelner Elemente der Gesellschaftlichkeit in we2 weiterbildbar oder vollendbar sind oder ob we2 umgekehrt durch Übernahme von Elementen in we1 höher zu bilden wäre, ergibt sich, dass beiden Systemtypen eine Reihe von Sozialelementen im Verhältnis zu wi überhaupt fehlen und dass sie im Weiteren in der Ausbildung der bereits wirklichen Elemente jeweils eigentümliche Mangelhaftigkeiten, Unvollständigkeiten, Auswüchse und Disproportionen besitzen. Die bereits ausgebildeten Elemente sind weder für sich allein noch in ihrer gegenseitigen Abstimmung harmonisch, noch können sie dies ohne Einführung der fehlenden Glieder werden. Bildlich: Aus einer Kombination oder Variation zweier jeweils unproportionierter Tierleiber kann nicht die Harmonie des Menschenleibes gebildet werden.
Von Wichtigkeit ist auch, dass die Entwicklungsländer we3 sich keineswegs nach den Sozialformen we1 und we2 richten müssten, um sich (or-om)-richtig weiterzuentwickeln, es wird vielmehr aus dem Vergleich mit wi sichtbar, dass und welche Mangelhaftigkeiten die beiden erwähnten Systemtypen besitzen. Die Entwicklungsländer könnten und sollten sich vielmehr unmittelbar nach dem Urbild wi fortbilden (durch Erstellung von Musterbildern). Diese Überlegung ist deshalb wichtig, weil hierdurch ihre Entwicklung unter Vermeidung einer Vielzahl von Fehlern, Mangelhaftigkeiten, Abirrungen in den Systemtypen we1 und we2 erfolgen kann. Die Entwicklungsländer müssten sich daher nicht etwa zuerst nach den grünen Sozialformen we1 oder denen in we2 richten oder beide Gesellschaftstypen nacheinander und in bestimmten Mischungen verwirklichen oder durchlaufen, sondern sie könnten sich unmittelbar bereits nach dem Urbild orientieren. Bildlich: Ein 15-Jähriger muss und sollte sich nicht in seiner Weiterentwicklung nach dem Verhalten eines 16- oder eines 18-Jährigen richten, die selbst noch nicht voll entwickelt sind und überdies ihnen jeweils eigentümliche Ungezogenheiten, Fehlbildungen und Irrtümlichkeiten an sich haben. Es ist für ihn sicher gebotener, sich auch für seine Entwicklung in der Pubertät nach den Grundsätzen zu orientieren, die für die Gesellschaftlichkeit der Vollerwachsenen gelten. Die Grundsätze der erwachsenen Menschheit sind eben im Urbild und den Erweiterungsschriften enthalten. Dieser theoretische Grundsatz ist aber mit folgenden pragmatischen Überlegungen abzustimmen:
Von besonderer Wichtigkeit ist hierbei die Frage, wann, wie und mit welchen Mitteln die Höherbildung in Richtung auf das Urbild erfolgen darf und soll.
· Urbegriff und Urbild dürfen nur übereinstimmig mit den Gesetzen der individuellen geschichtlichen Entwicklung hergestellt werden.
· Nach dem Gesetz der organischen, periodischen und zyklischen Entwicklung darf jeder bestimmte Urbegriff und jedes bestimmte Urbild eines jeden Teils der Lebensbestimmung nicht unbedingt überall hergestellt werden, sondern eine jede Idee zur rechten Zeit, am rechten Ort und auf diejenige eigenlebliche Weise, welche dem stetig werdenden individuellen Kunstwerk des Lebens gemäß ist.
· Das Bestehende ist daher unter Beachtung der Entwicklungsphasen und des historisch-realen Zustandes hinsichtlich seiner Unangemessenheit, Verspätung und Verfrühung genau zu prüfen.
· Bezüglich der einsetzbaren Mittel ergibt sich: Wer im Sinne der Grundwissenschaft arbeiten und wirken will, muss vorerst versuchen, sich selbst nach den oben angegebenen Geboten der Menschlichkeit zu erziehen.
Aus diesen Geboten ergibt sich u. a., dass dem Wesenwidrigen, Bösen, nicht wiederum Böses entgegengesetzt werden darf. Die gegen das Böse zulässigen Mittel und Verhaltensweisen sind daher genau zu beachten. Auch die Rechtsphilosophie (18) und (30) enthält diejenigen rechtmäßigen Mittel, die gegen rechtswidrige Zustände einsetzbar sind.
"Die Wesenlehre und insbesondere die Lehre vom Wesenleben und Wesenlebenbunde der Menschheit streitet mit keiner auf das Gute gerichteten Anstalt. Sie ist überhaupt nicht auf einen gewaltsamen Umsturz irgend eines Bestehenden, geschweige des bestehenden Schlechten, Vernunftwidrigen, Ungerechten, Unmenschlichen und Ungöttlichen gerichtet. Wohl aber ist sie gerichtet auf eine friedliche, liebinnige, liebfriedliche, vernunftgemäße, sittlichfreie Reinigung, Veredelung, Weiterausbildung, Wiedergeburt, kurz auf die Wesenbildung, auf die Ausbildung zu der gottähnlichen Reife alles Bestehenden. Sie ist also in keiner Hinsicht Feindin und Widersacherin des Bestehenden, soweit es gut und dem Guten zugewandt ist, wohl aber ist sie liebfriedliche Gegnerin und Heilkünstlerin des lebwirklichen Wesenwidrigen, Bösen, im wirklichen Leben." Wer im Sinne der Wesenlehre handeln will, hat sich jeder geistigen und leiblichen Gewalttat, sogar der Überredung zu enthalten und bleibt stets fern von Meuterei und Empörung. Eine rechtliche Befürwortung von Revolution ist nicht möglich.[23] Die Wesenlehre ist aber andererseits keine Lehre, die bestehende Systemtypen bereits für das Vernünftige, für das Vollendete hält, noch weniger ermöglicht sie die Rückkehr zu bereits überlebten Sozialformen. Durch die konkreten Grundrisse des Urbildes und der darin ausgebildeten Elemente der allharmonischen menschlichen Gesellschaftlichkeit enthält sie ein Leitbild, nach dem sich durch Erstellung von Musterbildern Einzelne, höhere gesellschaftliche Einheiten und schließlich ganze Völker weiterbilden können.
Das Urbild der Menschheit ist – wie bereits in der Einleitung erwähnt – eine relativ frühe Arbeit Krauses. Bei Beurteilung derselben ist zu beachten, dass er hier nicht die gesamte Präzision seiner Grundwissenschaft benutzte, sondern darum bemüht war, eine möglichst breit verständliche Version seiner Ideen abzufassen. Bei einer wissenschaftlichen Ausarbeitung müssen daher in allen Einzelbereichen die aus der Grundwissenschaft präzise abgeleiteten Spezialwerke Krauses mitberücksichtigt werden.[24]
Der Systemtyp we1 enthält nicht die menschlichen Universalien für die Entwicklung einer harmonischen Weltgesellschaft. Seine Parameter sind bestimmten unreifen Evolutionsstufen zugeordnet. Das Zentrum wäre sehr dazu angehalten, sich seiner eigenen Entwicklungsniveaus und seiner Fehlentwicklungen und Entartungen im Vergleich mit dem Urbild bewusst zu werden. Der 18-Jährige sollte sich die weiteren Reifestadien vergegenwärtigen, die er zu erreichen hätte.
In der Rechtsphilosophie (18, S. 131 f.) unterscheidet Krause sehr genau: "Weiter enthält der Organismus des menschlichen Rechtes sowohl diejenigen Bestimmnisse der zeitlichfreien Bedingtheit des Lebens, die sich aus der Unendlichkeit der Menschheit ergeben, als auch die, welche aus der inneren und äußeren Endlichkeit der Menschheit, ihrer Gesellschaften und Einzelmenschen hervorgehen, und für diese Endlichkeit erfordert werden, und zwar sowohl
· für die im Guten sich in ursprünglicher und eigenleblicher (individueller) wesengemäßer Beschränktheit (Endlichkeit), stufenweis entfaltende,
· als auch für die in wesenwidriger Beschränktheit (Endlichkeit) im Übel und im Bösen, sowie auch im Unglücke befangene Endlichkeit (die Fehlendlichkeit und Mangelendlichkeit)."
Es gibt daher
eine von Mängeln, Auswüchsen, Unrecht und Bösem weitgehend freie Möglichkeit der
Entfaltung in einem HLA neben der Variante, dass diese Entwicklung, etwa in der
Pubertät, gespickt und durchsetzt ist mit Entartungen, Disproportionen und
inadäquater sozialer Diskriminierung und Fixierung. Gerade Letzteres ist für die
Staaten des Zentrums hochgradig der Fall.
Die Staaten in we1 sind weiterhin keineswegs mündig, also voll erwachsen, was für die von ihnen dominierten anderen Systeme beachtliche Folgen hat. Mündig sind Völker, die ihr gesamtes inneres und äußeres Leben nach den Prinzipien des Urbildes und den darin enthaltenen Rechtsgrundlagen ausgebildet haben.
Wie verhält sich ein mündiges Volk "unmündigen" Völkern gegenüber? Es heißt in (63, S. 48): "Mündige Völker sind zu Erziehern noch unmündiger, kindlicher Völker berufen, allein sie müssen sich hierzu bilden und diese Erziehung mit Liebe, mit verständiger, sinniger und schöner Kunst treiben, nicht eigennützig, sondern mit der bewussten, alle Schritte der Erziehung leitenden Absicht, die Völker-Zöglinge mündig, sich selbst gleich oder noch schöner und lebenvoller als sich selbst zu machen."
Die Systeme des Zentrums sind daher in zweifacher Hinsicht weit von dieser Stufe entfernt. Sie leben selbst nicht mündig und daher ist im Weiteren auch ihr Verhalten den jüngeren Völkern gegenüber selbst nicht mündig. Die Reifung der Systeme we2 und we3 erfolgt daher im wilden Kampf mit den unmündigen 18-Jährigen. Es ist auch nicht mit Sicherheit abzusehen, welche Völker wann die hier erwähnte Mündigkeit erreichen werden.
Das Zentrum
besitzt keine aus dem Universalrecht, (Or-Om)-Recht, des Urbildes ableitbare
Legitimation für seine dominante, autoritäre Selbstbewertung und die demütigende
und herabsetzende Gestik gegenüber den anderen Systemtypen. Die strukturelle
politisch-wirtschaftlich-technisch-militärische Übervorteilung und
Entwicklungsbehinderung der beiden anderen Systemtypen ist im Universalrecht
nicht legitimierbar und daher zu Gunsten einer integrativ kooperativen
Grundhaltung zu verändern.
An einem konkreten Beispiel festgemacht: So wie das Internet, aus den partialen Technologien des Militärsektors stammend, global für friedliche Zwecke nutzbar gemacht wurde und eine Explosion an Wissensverfügbarkeit und Kommunikationsverdichtung erzeugte[25], so könnte sich die hybride Rationalität der derzeitigen Finanzmärkte in ein integratives Instrument der globalen Wirtschaft umwandeln, welches die komplexen Aufgaben einer Koordinierung globaler Wirtschaftsprozesse im Sinne einer letztlich gleichmäßigen Verteilung der wirtschaftlichen Ressourcen und Erträge übernimmt. Dabei wäre folgendes allgemeines Prinzip des Urbildes anzuwenden:
Die Parameter einer philosophischen Basis der Wirtschaft sind:
a)
Gliedbau der Wesen und Wesenheiten gemäß
dem
(Or-Om)-Gliedbau der Wesen und Wesenheiten, erkennbar im Wissenschaftsgliedbau,
wie er im Vorigen skizziert wurde.
b)
Bestimmung und (Or-Om)-Gliedbau der Gesellschaftlichkeit
des Einzel-menschen, höherer
gesellschaftlicher Einheiten und der Gesamtmenschheit im (Or-Om)-Gliedbau der
Wesen (gemäß dem Urbild der Menschheit) als Allhar-monie aller
Bestimmungen.
c)
Bedürfnisse,
gegliedert
nach dem Organismus der Bestimmung (nach der Allharmonie der Bestimmung).
d)
Wirtschaft
als Erzeugung, Verteilung, Gebrauch und Verbrauch aller nützlichen Güter ist
Teilbereich im Gliedbau der Wissenschaft und im Gliedbau der Kunst. Wirtschaft
ist eine selbständige Kunst, eine selbständige Wissenschaft und eine Vereinigung
beider. Wirtschaft als Kunst bzw. Wirtschaft als Wissenschaft und die
Vereinigung beider sind selbst durch alle Kategorien des Gliedbaus der Wesen und
Wesenheiten bestimmt, eigentümlich gekennzeichnet, auch in jeder ihrer
Einzeltätigkeiten jedes Einzelmenschen durch ein eigentümliches Verhältnis der
drei Grundelemente, Ur-Ich, Geist und Leib, determiniert (Finanzwissenschaft
ebenso wie Arbeit am Fließband). Wirtschaft steht im Weiteren in Beziehung zu
allen anderen inneren werktätigen Gesellschaften (Ethik, Recht, Religion,
Ästhetik). Der Aufbau der globalen Menschheit im "Urbild", der vorne in der
Weltsystemdebatte in der Entwicklungszykloide (vgl.: http://or-om.org/Weltsystem.htm )
dargestellt ist, dient auch hier als Schema. Das Werk (30, S. 480 ff.) enthält
eine mit der Struktur des "Urbildes" abgestimmte Darstellung des Organismus des
menschlichen Rechtes. Der Organismus des menschlichen Rechts nach den Sachen
wird vor allem in (30, S. 506 f.) behandelt.
Die
Bedürfnisse müssen auf die Bestimmung abgestimmt werden und aus den Bedürfnissen
ergibt sich der Organismus des Rechts sowie darin die rechtlichen Grundsätze für
die Organisationsstrukturen der Wirtschaft. Die Wirtschaftsformen bestimmen sich nach dem
Charakter der einzelnen Hauptlebensalter in der obigen
Entwicklungszykloide.[26]
Einige Positionen der derzeitigen Debatte der rechtlichen und sozialen Entwicklungsprobleme im Weltsystem – ein spezifischer Bereich der Rechts- und Staatsphilosophie – wollen wir in den Grundplan einordnen. Diese Positionen besitzen die Färbungen und Begrenzungen der Systemtypen, sind Kinder ihrer Systeme und deren Geschichte. Im Grundplan erscheinen sie kontrastierbar mit dem Urbild, vor allem dem Urbild des Rechtes und den Strukturen eines dort elaborierten Weltstaates im Menschheitsbund.[27]
In der Bearbeitung der Probleme und der Suche nach Prinzipien globaler Gerechtigkeit werden gegenüber einem Weltstaatsmodell derzeit offensichtlich große Bedenken vorgebracht. Es wird daher an dessen Stelle das Modell einer Weltrepublik diskutiert, worunter man die "Übereinstimmung des Rechts und die Gemeinschaft des Nutzens" zu verstehen hätte. Der Weltstaat als institutioneller Kosmopolitismus wird gerne als die Bedrohung einer Weltrepublik betrachtet. Schon Kant, der in der Diskussion eine starke Wiederbelebung erfährt, sah die Gefahr eines Weltdespotismus. Jedenfalls müssten in diesen Theorien die Prinzipien der politischen Gerechtigkeit im Weltmaßstab von den Prinzipien der politischen Gerechtigkeit in Einzelstaaten wesentlich abweichen. Man unterscheidet daher in der Debatte
a) zwischen einer politischen Gerechtigkeit zwischen Individuen im Einzelstaat einerseits und
b) einer internationalen Gerechtigkeit primär zwischen Staaten andererseits.
In der zweistufigen Vertragstheorie Rawls etwa wird im "ursprünglichen Zustand" unter dem "Schleier der Unwissenheit" über Gerechtigkeitsprinzipien entschieden. Auf der ersten Stufe von den Individuen im liberalen Staat, auf der zweiten Stufe von den Staaten in der gerechten Weltordnung. Dabei müssen die in der zweiten Stufe beteiligten Staaten nicht einmal die Gerechtigkeitsprinzipien der ersten Stufe angenommen haben. Kritikern dieser Zweistufigkeit, vor allem den sogenannten "Globalisten" (Beitz, Pogge), geht es dagegen um mehr als eine bloß internationale Gerechtigkeit. Sie fordern eine genuin globale Gerechtigkeit. Dies geht wieder vielen anderen zu weit, die damit einen Weltstaat heraufziehen sehen.
Die Zweistufigkeit erzeugt auch das Problem, dass Inhalt und Ausmaß der Menschenrechtskataloge im innerstaatlichen Bereich (substanzielle Rechte des Staatsbürgers) beträchtlich von den weltweiten Individualrechten des Weltbürgers abweichen können und auch deshalb dürften, weil internationaler Konsens wesentlich schwerer zu erzielen ist. Manche Autoren lehnen die konsenstheoretische Begründung der Menschenrechte ab und fordern eine kohärenztheoretische substantielle Interpretation. Hieraus ergäben sich etwa das Diskriminierungsverbot, der Schutz der persönlichen Integrität, woraus sich auch das Recht auf Immigration im Fall extremer Armut ergibt, und die allgemein verträglichen Formen der individuellen Selbstbestimmung, aus denen sich die entsprechenden sozialen, politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Rechte ergeben.
Drei kantisch inspirierte Entwürfe einer Weltrepublik liegen derzeit vor. Anders als bei Kants Idee einer Weltrepublik bzw. eines Völkerstaates in seiner Arbeit "Zum ewigen Frieden" gilt für Höffe, trotz seiner kantischen Inspiration, eine Weltrepublik als durchaus erreichbar: Es handelt sich sozusagen um eine reale Utopie (realistische Vision). Dieses Projekt steht in deutlichem Kontrast zu den beiden anderen Stellungnahmen zur globalen Gerechtigkeit. Der Entwurf Rawls geht nicht über die kantische Idee eines friedensichernden Völkerrechts hinaus. Habermas wiederum sieht die Verwirklichung einer global governance "schon unterwegs"; seiner Auffassung nach sollte es bei einer soft governance ohne die staatliche und rechtlich-institutionelle Dimension einer Weltrepublik bleiben. Auf die von uns oben dargestellten gewaltigen Dominanz- und Hegemonialzustände zwischen Zentrum und Peripherien bezogen, geht etwa Forst[28]davon aus, dass sowohl bei Rawls als auch bei Höffe die Theorie eigentlich eine moralisch-politische Konstruktion gleichursprünglicher Prinzipien lokaler und globaler Gerechtigkeit forderte. Dazu gehört nach Forst wesentlich eine Pflicht derjenigen, die Macht haben und von Ungerechtigkeiten profitieren, eine gerechte globale Grundstruktur zu etablieren, in der die Mitglieder faire Chancen hätten, an der Entwicklung von Regeln und Institutionen mitzuwirken, die effektiv genug sind, um (interne und externe) politische und ökonomische Ungerechtigkeiten zu bekämpfen. Die Debatte beschäftigt sich auch mit der Frage des Übergangs vom Ist-Zustand zu den angestrebten Modellzielen. Hierbei wird überwiegend die Beachtung des Demokratieprinzips für die Willensbildung der betroffenen Menschen befürwortet. Wie soll aber der Wille der Einzelstaaten im Verhältnis zu dem seiner Bürger berücksichtigt werden?
Die Beziehung zwischen Einzelstaaten und der Staatlichkeit der Weltrepublik bildet weitere Flächen der Diskussion. Obliegt die Sicherung des internationalen Friedens der "komplementären Weltrepublik"? Auch wenn Souveränitätsübertragungen nötig sein dürften, nimmt ein Teil der Ansätze an, dass die Einzelstaaten weiterhin wichtige Funktionen in der Weltpolitik spielen sollen. Auch an eine kontinentale Zwischenstufe wird gedacht.
Andere gehen von der These einer (teilweisen) Entmachtung des Staates aus. Die demokratische, nationalstaatliche Republik sei durch die beispiellose Intensivierung, globale Ausdehnung und Beschleunigung grenzüberschreitender Bewegungen von Gütern, Dienstleistungen, Arbeit, Kapital, Ideen, Informationen, kulturellen Symbolen, kriminellen Aktionen usw. überfordert.
Wichtig erscheint auch die Diskussion des Legitimitätsproblems auf dem Weg zur Weltrepublik: Dürfen autokratische Staaten, immerhin über die Hälfte aller Staaten, an den demokratischen Entscheidungsprozessen weltrepublikanischer Institutionen teilnehmen (Frage einer Einbindungs- oder einer Anreizstrategie)?
Auch die Idee des Gemeineigentums der gesamten Menschheit an der Erde taucht am Horizont der Diskussion als Legitimationsbasis zur Herstellung gerechterer sozialer Zustände auf.
In diesem Zusammenhang klingen auch Fragen der verschiedenen Modelle an, welche das Verhältnis zwischen den Begriffen Staat und Volk regeln. Zur Diskussion stehen: 1. Das unproblematische Einheitsmodell, in dem die Staatsbürger einer einzigen kulturellen Gruppe angehören; 2. das Assimilationsmodell traditioneller Einwanderungsländer; 3. das Modell des Minderheitenschutzes (welche Minderheit verdient welchen Schutz?) und 4. das Autonomiemodell. Schließlich sind noch Teilungs-, Spaltungs- und Auflösungsmodelle denkbar. Es besteht vor allem das Problem, inwieweit kollektive Identitäten einer Minderheit selbst durch ihre Konstituierung die Individualrechte der Betroffenen einschränken und damit verletzen. Manche sprechen den Völkern jegliche kollektive Rechte ab, die sich nicht aus den Rechten der Individuen legitimieren ließen. Nationen seien juristisch unklare Wesen und imaginäre Gemeinschaften, deren Merkmale und Bedeutung von den Mitgliedern immer wieder neu definiert werden. In liberalen Staaten seien Minderheitenprobleme in einem pluralistischen Rahmen liberalisierend zu lösen.
Alle wissenschaftlichen Arbeiten und Bestrebungen, die sich theoretisch mit der Herstellung der Einheit der Menschheit beschäftigen, sind grundsätzlich systematisch zu erfassen und zu bewerten. Im Vergleich mit dem Urbild wi ist auch zu prüfen, inwieweit sie in den "allgemeinen Strom" integriert werden können, welcher unendlich viele mögliche Einzelansätze und Bestrebungen in den Gesamtbau einfügt, der sich aus dem (Or-Om)-Riss des Urbildes ergibt.
Bei Höffe findet sich folgender denkwürdige Befund: "Zu einem lebensweltlich dringenden Problem, dringend für die Menschheit seit ihren Anfängen, bietet die Philosophie so wenige Vorbereitungen an, dass wir uns an das Thema noch herantasten müssen. Wir suchen keine runde Theorie, Bausteine für eine künftige Theorie aber doch. Der erste Baustein hält das Defizit fest: In der längsten Zeit der Philosophiegeschichte fehlt es an einer Theorie der internationalen Rechts- und Friedensgemeinschaft."
Hier zeigt sich wiederum, dass oft nicht nur schon einzelne Bausteine, sondern ganze Gebäude gewaltigen Ausmaßes unbemerkt errichtet wurden, die nur der Benutzung harren. Während also Höffe aus einzelnen Bausteinen Kants sich an eine Theorie einer internationalen Rechtsordnung heranzutasten versucht, hatte Krause schon durch seine profunde Kant-Kritik, vor allem aber durch seine eigenen erkenntnistheoretischen Neuerungen, aus denen er eine Rechtsphilosophie der Menschheit entwickelte, die Baupläne für die weitere Entwicklung der Menschheit in einer inhaltlichen Präzision erstellt, was Kant infolge seiner Erkenntnisbegrenzungen nicht möglich gewesen wäre. Während sich daher die heutige Theorie der internationalen Rechtstheorie intuitiv aus den Bereichen der Einzelstaatlichkeit und den dort etablierten Prinzipien allmählich zum Modell einer Rechtsordnung der Weltgesellschaft hinauftastet, hat Krause bereits deduktiv einen Bauriss für die Rechtsposition der gesamten Menschheit und für alle ihre Teile mit unmittelbar umsetzbarer Genauigkeit in den Details entwickelt, die wir in unserem Grundplan mit den Zuständen im Weltsystem in Verbindung bringen. Um diesen Ansatz für die Zukunft der Menschheit nutzbar zu machen, sind jedoch die erkenntnistheoretischen Grenzen Kants, die vorne skizziert wurden und die Krause vor allem in (41, S. 10 ff.) ausführlich kritisierte und weiterführte, zu überschreiten. Es geht um die sich aus den Erkenntnisfortschritten ergebenden inhaltlichen Neuerungen der Grundwissenschaft, in denen auch das Staats- und Menschheitsrecht völlig neue Perspektiven erhält. Schon Krause schrieb zu Kants teleologischer Philosophie:
"Diese Lehre ist rein subjectiv und formal, wie auch seine theoretische und seine praktische Philosophie, wovon der Hauptgrund in Kants Ideenlehre liegt, wonach den Ideen nur subjektive und formale und bloss regulative (nicht konstitutive) Bedeutung und Gültigkeit in jedem Vernunftgebrauche zukommt" (41, S. 54).
"Die Lehre von der Annäherung an einen allgemeinen, erdumfassenden, friedlichen Völkerstaat. (Siehe: Zum ewigen Frieden, ein philosophischer Entwurf. 2. verm. Auflage 1796, Rechtslehre S. 259 f. und Kritik der Urteilskraft § 83. S. 3, 89).
Kritik. a) Schon früher von
Freunden der Menschheit geahnt. König Heinrich IV.,
St. Pierre.
b) Es ist dies ein Lichtpunkt des Kant'schen Systems.
c) Aber die Idee eines Menschheitsstaates auf Erden ist noch nicht entfaltet. S. Näheres hierüber in folgenden meiner Schriften: Urbild der Menschheit, Tagblatt des Menschheitlebens, Abriss der Rechtsphilosophie, Vorlesungen über Rechtsphilosophie. In letzteren wird die Idee des Staates erfasst und darin untergeordnet die Idee des einen Völkerstaates nach-gewiesen und organisiert" (41, S. 72).
In einem
Ansatz, der seine eigene selbstreferentielle Widersprüchlichkeit anerkennt und
damit seine Position wohl auch abschwächt, versucht Beck (Be 02) in einen
kosmopolitischen Machiavellismus, ein kosmopolitisches Regime für alle – als
einer Variante des früheren Internationalismus – zu entwerfen. Die Utopie geht
von einer neuen, grenzenlosen Einheit der Menschheit aus.
Gegen den westlichen Universalismus, der das Andere (die anderen Systeme) als minderwertig, zurückgeblieben deklariert und alle anderen dominiere, gelte es, eine globale Macht- und Rechtsordnung zu errichten, die im Gegensatz hierzu die radikale Wiederfindung und Anerkennung des Anderen (des kulturell Anderen, Andersheit der anderen Zukunft, Andersheit der Natur, Andersheit des Objektes und die Andersheit anderer Rationalitäten) beinhalte.
Die globalen Bedrohungen führen
zu einem Abbau der Grundrechte der Moderne und zur Gefahr eines kosmopolitischen
Despotismus. Es wird daher ein Menschenrechtsregime gefordert, welches nicht
mehr in der Territorialität des Nationalen und des Staates wurzelt, sondern in
der fingierten Unmittelbarkeit von Individuum und Globalität und welches
keinen demokratischen Kontrollen unterworfen ist.
Die Legitimität dieses Regimes kann nicht aus den Legitimationsquellen der begrenzten territorialen Nationalstaatsordnung hergeleitet werden. Es bedürfe einer revolutionären Überwindung dieser Nationalstaatsordnung durch kosmopolitische undemokratische Setzung, die sich ethisch (Kant), empirisch (Rechtspositivismus) und pragmatisch-politisch (Pragmatismus) einlöst. Dies geschehe mit der "Vernunft", die nach dem Ende der Vernunft Geltung gewinne, mittels der pragmatisch-postmodernen "Setzungsvernunft". Es hätte keinen Sinn, über das Allgemeinverbindlich-Gute (schlechthin Gute) abzustimmen. Diese Selbstbegründung des Guten sei zeitlos (Metaphysik der ewigen Gegenwart), anstelle der demokratischen Abstimmung trete die Einsicht. Uneinsichtige aber müssten ausgegrenzt werden. Spätestens hier verliert der Ansatz seine selbstreferentielle Konsistenz. Während oben die radikale Anerkennung des Anderen als Anderen gefordert wird, soll hier beim "uneinsichtigen Anderen", der sich "dem stillen Zwang, der zur Einsicht in das Gute führt", der Macht der Selbstlegitimation wiedersetzt, das Prinzip des Nichtausschlusses des Anderen wieder radikal zurückgenommen werden.
Dieser Ansatz wird hier als typischer Fall eines aus den Bedingungen des I. HLA, 3 stammenden Versuches erwähnt, aus den Mängeln der derzeitigen Ordnung der Systemtypen, im Bemühen nach der Herstellung der Einheit der Menschheit einen radikalen, undemokratischen Sprung vorzuschlagen. Die Mängel der Nationalstaatlichkeit[29] sollen zur Eliminierung des Staates überhaupt führen, die Selbstlegitimierung des neuen kosmopolitischen Regimes erfolgt nicht demokratisch und die Uneinsichtigen werden ausgegrenzt. Eine inhaltliche Durchgestaltung des neuen Regimes fehlt völlig.
In den obigen Grundplan als ein Ansatz in we1 eingefügt und mit den Ideen der Wesenlehre wi verglichen, erweist sich derselbe in seiner Logik, offensichtlich in der Hegel-Marx-Tradition stehend, als radikal einseitig in der Legitimierung und als äußerst bedenklich in den Vorschlägen zur Realisierung des Modells. Durch die Zerstörung oder Eliminierung von Institutionen sollte keine Weiterbildung des Bestehenden erfolgen. Die Legitimierung etwa der Grundprinzipien des Rechts im Sinne der Wesenlehre ist sachlich "theonom" in Gott gelegen. Diese Ideen können von Menschen gar nicht geschaffen werden. Will man diese Prinzipien aber einführen, dann ist dies nicht durch Zwang, Gewalt, List, Revolution usw. zulässig. Der Umstand, dass die verschiedenen Systemtypen im Weltsystem in verschiedenen Phasen der Jugend stehen, ist bei Schritten zur Veränderung im Sinne der neuen Ideen des Weltstaates unbedingt zu berücksichtigen.
Bereits im Kapitel "Intermezzo Postmoderne" zeigten wir das Auseinandertreten der Vernunftkonzepte in der westlichen Moderne und die Mängel der Versuche, unterschiedliche, inhaltlich nicht kompatible Vernunftkonzepte in einem über-geordneten vernünftigen Verwaltungsverfahren adäquat aufeinander zu beziehen. Die interkulturelle Theorie der Vernunft stellt eine weitere Variante in diesen Ansätzen dar und spiegelt die von uns oben dargestellte Spannung im Weltsystem zwischen den Dominanzkonzepten des Zentrums und den erniedrigten Peripherien (nach Wimmer eine Auseinandersetzung mit dem rassistischen "Superioritätsbewusstsein" Europas). Versucht wird die Dekonstruktion der kulturell dominanten einen westlichen Vernunft.[30] Die Ablehnung des Göttlichen als Maß des Menschlichen (Heidegger) sowie die Kritik des Identitätsdenkens (Adorno) und die Philosophie der Differenz (Levinas, Foucault, Deleuze, Lyotard, Derrida, Kristeva und Irigary) werden als Vorläufer betrachtet. Philosophie spielt sich als eine Vielzahl von Dialogen zwischen Philosophien verschiedener Kulturen ab – nach Wimmer als "Polylog". Die Dialogpartner besitzen alle die gleiche Rangordnung. Kimmerle meint auch, dass es in der Philosophie im Blick auf das eigentlich Philosophische keine Geschichte und jedenfalls keinen Fortschritt gibt. Es sei ein Fehler, andere Kulturen auf einer früheren Entwicklungsstufe zu fixieren. Das Entwicklungs- und Zeitdenken der Ethnologie bedinge, dass der Andere der anderen Kultur nicht in seiner Verschiedenheit und Gleichrangigkeit erfasst würde. Es gäbe auch keine Höherentwicklung von früheren zu späteren Philosophien und kein grundsätzliches Höher- und Tieferstehen gleichzeitig nebeneinander bestehender Kulturen und Philosophien.
Die Suche nach kulturellen Universalien (cultural universals) wird in unterschiedlicher Weise versucht. Eine Universalsprache, auf welche sich die verschiedenen Sprachen beziehen lassen, wird abgelehnt.[31] In der Bewertung anderer Kulturen sollten besonders die bisher ausgeklammerten Kulturleistungen der oralen Kulturen[32] und animistischen Religionsformen berücksichtigt werden. Auch die von uns betonte Herauslösung (Emanzipation) des Philosophischen aus Mythos und Religion wird erkannt. Gerade bei diesem Schritt handelt es sich aber bereits um eine evolutionäre Veränderung, die in der interkulturellen Philosophie umgekehrt eigentlich abgelehnt wird.
Der "Raum des Dazwischen" (intermediate space), der zwischen Tradition und Modernität liegt und welcher von uns oben ausführlich behandelt wurde, wird thematisiert.
Die Überlegung, dass es eine ethnozentrische "europäische" Vernunfttradition gäbe, die im Rahmen der interkulturellen Verflechtungen, in ihren Grundfesten paradigmatisch erschüttert, durch eine Theorie der interkulturellen Vernunft zu ersetzen sei, wird etwa von Mall in seinem Aufsatz: "Zur interkulturellen Theorie der Vernunft – Ein Paradigmenwechsel" vorgebracht. Zu prüfen wird allerdings sein, ob dieses Konzept tatsächlich so stark von bisherigen Vernunftkonzepten abweicht, dass man von einem Paradigmenwechsel sprechen kann.
"Unter der Überschrift 'zur
interkulturellen Theorie der Vernunft' plädiere ich für eine Theorie der
Vernunft, die interkulturelle Überlappungen aufweist, jenseits der Fiktionen der
nur einen Vernunft und der vielen Vernunftformen, was einem Paradigmenwechsel
gleichkommt. Darüber hinaus geht es um eine interkulturelle Vernunft als eine
überlappende Gegebenheit unter den Kulturschöpfungen. Eine solche Rationalität
unterscheidet sich von dem klassischen Paradigma eines starren Vernunftvermögens
a priori und weist auf empirischem Wege auf das Zustandekommen einer
interkulturellen Vernunft hin. Wir versuchen auf folgende Fragen eine Antwort zu
geben: Gibt es die Universalität der Vernunft? Wie kommt sie zustande? Letzten
Endes geht es um eine Verankerung der Vernunft, die weder theologischer noch
bloß metaphysisch-spekulativer, sondern eher anthropologischer Natur ist."
"Stellen wir die Frage: Wann
sind zwei oder mehrere Vernunftbegriffe radikal verschieden und wann nur
unterschiedlich, so müsste die Antwort lauten: Sie sind radikal verschieden,
wenn sie selbst als Vernunftbegriffe verschieden sind. Sie sind jedoch
unterschiedlich, wenn sie als unterschiedliche Vernunftbegriffe aufgefasst
werden können. In diesem Fall gehören beide zum Oberbegriff
Vernunft."
"Die metonymische Vernunft
weist gerade den Anspruch einer lokalen Vernunft als die Vernunft zurück, weil sie von der
Überzeugung ausgeht, dass die eine allgemeine Vernunft zwar der lokalen
Vernunftformen bedarf, in ihnen jedoch nicht aufgeht."
"Am Ende zeigt sich, dass
die interkulturelle Relativierung der Vernunft nicht die eine allgemeine
überlappende, orthaft ortlose Vernunft relativiert, sondern nur den
absolutistisch universalistischen Anspruch der einen kulturellen Vernunft
dekonstruiert. Darüber hinaus gilt es zu beachten, dass selbst die europäische
Vernunft nicht immer eine einheitliche Sprache spricht.[33]
Eine Vernunft, die sehend
und fundierend sein will, erfährt eine interkulturelle Begründung und
Rechtfertigung. Das indische Konzept des Bewusstseins könnte in diesem Sinne
gedeutet werden. Will aber eine Vernunft darüber hinaus konstitutiv und
universell sein, so verliert sie ihre interkulturelle Verankerung, und
demzufolge ist sie nicht differenzierend genug. Ferner ist sie diskriminierend,
was der Aufgabe einer interkulturellen philosophischen Verständigung im Wege
steht, nämlich die anderen zu verstehen und von ihnen verstanden zu werden.
So ist klar, dass es sich
bei der interkulturellen Vernunft nicht um eine formal-mathematische und bloß
analytisch-definitorische Rationalität handelt, die in dem Formalismus der
Logik, Semantik und der formalen Ontologie zum Ausdruck kommt.[34]
Eine solche Vernunft ist zwar universell, bleibt jedoch leer. Die so erreichte
Universalität bezahlt den hohen Preis der Abstraktion von allen Inhalten. Am
anderen Ende gibt es die lokale kulturelle Vernunft, die alle Arten von
Skeptizismus und Relativismus unterstützt. In ihrer extremen Form ist eine
solche Vernunft nicht in der Lage, Kommunikationen zu fördern.
Die interkulturelle
Rationalität weist die leere formale Rationalität in die Schranken der rein
formalen Wissenschaften und billigt ihr außerhalb ebenso wenig Geltung zu wie
der extrem relativistischen, individualistischen Partikularität. Fast möchte man
meinen, dass die interkulturelle Rationalität eher auf die Hegel'sche konkrete
Universität zielt, diese jedoch im Gegensatz zum Hegel'schen Anspruch orthaft
ortlos sein lässt und sie nicht stufentheoretisch traktiert. Daher ist die
Universalität der interkulturellen Rationalität nicht etwas, was der kulturellen
Pluralität von außen aufgestülpt wird; sie ist die Universalität der erlebten
Überlappungen jenseits aller Relativismen, Essentialismen und Formalismen.
So wie die eine philosophia
perennis mehrere Sprachen spricht und keine Tradition ausschließlich
privilegiert, so drückt sich die eine Vernunft in unterschiedlichen Kulturen
aus. Die interkulturelle Relativierung der Vernunft bedeutet daher das
Zurückweisen des Anspruchs, irgendeine bestimmte kulturelle Sedimentation der
Vernunft mit der einen Vernunft gleichzusetzen.
Die
überlappende Universalität vernünftigen Denkens lebt in den lokalen, kulturellen
Differenzen, transzendiert diese jedoch. Sie verhält sich so wie das Allgemeine,
das zwar des Partikulären bedarf, in ihm jedoch nicht ganz aufgeht. Wenn es
stimmt, dass es eine überlappende universale Vernunft gibt, dann ist es ein
Unding, diese exklusiv mit Adjektiven wie europäisch, indisch oder chinesisch
belegen zu wollen. Die analogische metonymische Rationalität geht von einer
Vernunft als einem überspannenden Rahmen aus und postiert diese in den
Überlappungen. Die Adjektive wie europäisch, indisch, chinesisch usw. deuten auf
den entsprechenden Kulturkontext hin und das Nomen Vernunft auf die
Allgemeinheit derselben in ihrem umspannenden Rahmen. So entpuppt sich die hier
skizzierte Theorie einer interkulturellen Vernunft als ein Plädoyer für eine
universale, aber orthaft ortlose Rationalität und weist auf einen
Paradigmenwechsel hin."
Die Annahme, die Theorie der interkulturellen Vernunft entgehe selbst universell gültigen Vernunftinstanzen a priori, sie enthalte nichts von der einen Vernunft und deren Ausformungen jenseits verschiedener Kulturen, sie sei nicht, sondern ereigne sich in der Gestalt von Vermischungen, Kreuzungen, Verwebungen, Teilungen und dem ständigen Austausch, hält den von uns bereits mehrmals erwähnten Kriterien der selbstrefentiellen Konsistenz nicht stand.[35] Die obigen Sätze müssen, um sinnvoll vertretbar zu sein, jenseits allem Sich-Ereignens als Unwerdendes, a priori, universell und unveränderbar und auch jenseits aller Überlappungen kulturell ausgeprägter Vernunftkonzepte bestehen bleiben. Sie sind jedem interkulturellen Vernunftdiskurs als unhinterfragbare, transzendentale Struktur und Grundlage der Vernunft entzogen, widersprechen daher ihren eigenen Forderungen und Ansprüchen. In den obigen Sätzen wird also entgegen den Behauptungen derselben absolutistisch ein universalistischer Anspruch einer Vernunft konstruiert und konstituiert, der lokal wohl nicht ortbar und bestimmbar ist und der selbst keinerlei Grundlage und Begründung im Paradigma der Theorie der interkulturellen Vernunft findet und daher einen eindeutigen Legitimierungsbedarf besitzt. Die obigen Sätze sind gerade das, was sie bekämpfen: konstitutiv, universell, ohne interkulturelle Verankerung und daher "nicht differenzierend genug".
Im Zusammenhang unserer obigen Ausführungen ist primär festzuhalten, dass alle bisherigen europäisch-amerikanische Vernunftkonzeptionen evolutionslogische Mängel gegenüber der Vernunft der Grundwissenschaft besitzen. Dies gilt in gleicher Weise für die Vernunftkonzepte anderer Kulturen anderer Kontinente. Weiterhin ist davon auszugehen, dass im Rahmen der dargelegten Grundlagen der unendlichen und unbedingten Prinzipien der göttlichen Vernunft alle bisherigen Vernunftkonzepte aller Kulturen evolutionslogisch ihren Platz einnehmen, aber eben auch zu fragen ist, ob und wieweit sie die "letzten" oder "höchsten" Formen der Evolution der menschlichen Vernunft erreicht (oder nicht erreicht) hätten. Hierbei sind eben auch alle bisherigen Vernunftkonzepte aller Kulturen, die von göttlichen Grundlagen der menschlichen Vernunft ausgingen, mit der Grundwissenschaft zu vergleichen. Dieser Vergleich stellt eine wichtige künftige Aufgabe der interkulturellen Vernunftdiskussion dar. Noch sind hier im Wissenschaftsbetrieb Schätze und Potenziale anderer Kulturen erst spärlich erschlossen.
Die Theorie der interkulturellen Vernunft, deren
interne Mängel hier nur skizziert werden, bildet einerseits eine Behinderung für
weitere Evolutionsschritte der Vernunftdiskussion, sie kann aber die
interkulturelle – (or-om)-universale – These der Vernunft, die sich aus der
Wesenlehre ergibt, selbst in ihrem eigenen Bezugssystem als eine interkulturelle
Lehre prüfen und sich in dieser selbst weiterbilden. Dabei wird sie auf die
Ideen und die Ideale einer allharmonischen Planetenmenschheit stoßen: Eine
Lehre, die infolge ihrer Beziehungen zur göttlichen Vernunft allgegenwärtig ist, an kein Volk und
keinen Punkt der Erde gebunden und doch geeignet, die Grundlage für ihre
harmonische Vollendung als Planetenmenschheit zu bilden. Wir wissen daher nicht,
an welchem Ort der Erde sie im interkulturellen Diskurs Anerkennung und
Umsetzung erfahren wird.
Es zeigt sich im Weiteren, dass es in der göttlichen
Vernunft ableitbare Universalien gibt, die insoweit kulturelle (oder
interkulturelle) Universalien darstellen, als sie in ihrer (Or-Om)-Universalität
geeignet sind, die Kultur der Einheit der Menschheit zu bilden, in der
alle bisherigen Kulturen, Völker, Staaten und Traditionen unter Beibehaltung
maximaler Individualität harmonisch als eine Menschheit leben.
Der interkulturellen Philosophie ist nicht zu
empfehlen, die Frage einer Evolution von Kulturen oder Gesellschaften als
dominanzverdächtig beiseite zu legen. Sie selbst als Disziplin ist ja ein Kind
einer typischen globalen Evolution. Dort, wo sich die interkulturelle
Philosophie bewertend in die überlappende Vernunftdiskussion zwischen
Kulturen einmischt, etwa wenn sie die Rigidität islamischer Gemeinschaften
kritisiert, nimmt sie selbst wiederum evolutionistische Positionen ein. Es führt
zu beachtlichen Problemen, wenn man die Frage einer Evolution der
Weltgesellschaft ablehnt, weil dann die internen kulturellen Parameter
einer jeden Partialkultur, wie "entsetzlich" sie vielleicht auch anmuten, im
interkulturellen Diskurs ohne inhaltliche Kritik als individuelle
Ausformungen gleichrangig anzuerkennen wären. Umgekehrt enthält eine
inhaltlich orientierte interkulturelle Theorie, die etwa gegen die
formal-prozedurale Diskursethik Apels die materiale Universalität einer
Befreiungsethik als Reformulierung einer globalen Verantwortungsethik setzt
(Dussel), auf jeden Fall evolutive Aspekte und Ideen der Überschreitung der
kulturell-politischen Strukturen aller partialen Vernunftkonzepte in Zentrum und
Peripherien in einer der Theorie selbst widersprechenden Weise.
Andererseits wehrt sich interkulturelle Philosophie zu Recht gegen den evolutionistischen Hochmut des Westens des 18-Jährigen. Die Evolutionslehre der Grundwissenschaft möge jedoch, wie wir schon mehrmals betonten, nicht als ein neuer "westlicher" Dominanz-Evolutionismus beurteilt werden. Sie erkennt alle bisherigen Evolutionsniveaus aller Staaten, Völker und Kulturen in nicht dominanter Weise als Anderes zu sich selbst, enthält sie aber alle in sich als historische Ausformungen we1, we2 und we3 im Verhältnis zum Urbild wi der erwachsenen Menschheit im vorne dargestellten Grundplan. Erst aus ihren Prinzipien ergibt sich eine neue Erkenntnis des Verhältnisses von Gleichrangigkeit aller Menschen und ihrer Unterschiedlichkeit und Andersheit.
Schließlich wird die interkulturelle Philosophie letztlich nicht umhin können, die vorne dargestellte Differenzierung der Erkenntnisschulen (1) – (5) in ihre Analysen aufzunehmen. In fast allen derzeitigen Sozial- und Kultursystemen der drei Systemtypen sind gleichzeitig eine Mehrzahl von (oft politisch) konkurrierenden, keineswegs kompatiblen Philosophien gesellschaftlich wirksam, die im Sinne der obigen Erkenntnisschulen unterschiedliche erkenntnistheoretische Begrenzungen und damit Vernunftkonzepte besitzen. Es gibt kaum Monokulturen gesellschaftlich etablierter Philosophie. Damit wird aber die überlappend sanft universalistische Funktion der interkulturellen Vernunft selbst unbedingt inhaltlich überfordert, wenn sie die Metafunktion der repressionsfreien Verwaltung der internen, konkurrierenden und inkompatiblen Konzepte einerseits und aller internen und externen Theorien der Interkulturalität andererseits im Rahmen ihrer Theorie der Überlappungen adäquat erfüllen wollte.
|
|
Zu Lebzeiten des Verfassers sind erschienen: |
|
|
|
|
(1) |
Dissertatio philosophico-mathematica de Philosophiae et Matheseos notione et earum intima conjunctione. Jenae, apud Voigtium, 1802 (vgl. Nr. 53). |
|
(2) |
Grundlage des Naturrechts,
oder philosophischer Grundriss des Ideales des Rechts. Erste Abtheilung.
Jena, Gabler (Cnobloch), 1803 (vgl. |
|
(3) |
Grundriss der historischen Logik für Vorlesungen, nebst zwei Kupfer-tafeln, worauf die Verhältnisse der Begriffe und der Schlüsse combina-torisch vollständig dargestellt sind. Jena, Gabler (Cnobloch), 1803. |
|
(4) |
Grundlage eines philosophischen Systemes der Mathematik; erster Theil, enthaltend eine Abhandlung über den Begriff und die Eintheilung der Mathematik, und der Arithmetik erste Abtheilung; zum Selbstunterricht und zum Gebrauche bei Vorlesungen, mit 2 Kupfertafeln. Jena und Leipzig, Gabler (Cnobloch), 1804. |
|
(5) |
Factoren- und Primzahlentafeln, von 1 bis 100000 neuberechnet und zweckmässig eingerichtet, nebst einer Gebrauchsanleitung und Abhand-lung der Lehre von Factoren und Primzahlen, worin diese Lehre nach einer neuen Methode abgehandelt, und die Frage über das Gesetz der Primzahlenreihe entschieden ist. Jena und Leipzig, Gabler (Cnob-loch),1804. |
|
(6) |
Entwurf des Systemes der Philosophie; erste Abtheilung, enthaltend die allgemeine Philosophie, nebst einer Anleitung zur Naturphilosophie. Für Vorlesungen. Jena und Leipzig, Cnobloch, 1804. (Die zweite Abtheilung sollte die Philosophie der Vernunft oder des Geistes, die dritte die Philo-sophie der Menschheit enthalten.) |
|
(7) |
System der Sittenlehre; I. Band, wissenschaftliche Begründung der Sittenlehre. Leipzig, Reclam, 1810 (vgl. Nr. 40). |
| (8) | Tagblatt des Menschheitlebens; erster Vierteljahrgang 1811, Dresden in der Arnold'schen Buchhandlung und bei dem Herausgeber D. Krause. |
|
(9) |
Das Urbild der Menschheit, ein Versuch. Dresden, Arnold, 1811. – Zweite Auflage Göttingen, in Commission der Dieterich'schen Buch-handlung, 1851. |
|
(10) |
Lehrbuch
der Combinationslehre und der Arithmetik als Grundlage des
Lehrvortrages und des Selbstunterrichtes, nebst einer neuen und
fasslichen Darstellung der Lehre vom Unendlichen und Endlichen, und einem
Elementarbeweis des binomischen polynomischen Lehrsatzes, bearbeitet von
L. Jos. Fischer und D. Krause, nach dem Plane und mit einer Vorrede und
Einleitung des Letztgenannten. Erster Band. Dresden, Arnold'sche
Buchhandlung, 1812. |
|
(11) |
Oratio de scientia humana et de via ad eam
perveniendi, habita Berolini 1814 (vgl. Nr. 43). |
|
(12) |
Von der Würde der deutschen Sprache und von der höheren Ausbildung derselben überhaupt, und als Wissenschaftssprache insbesondere. Dresden, 1816. |
|
(13) |
Ausführliche Ankündigung
eines neuen, vollständigen Wörterbuches oder Urwortthumes der deutschen
Volkssprache. Dresden,
Arnold, 1816. |
|
(14) |
Theses philosophicae XXV, Gottingae, 1824
(vgl. Nr. 43). |
|
(15) |
Abriss
des Systemes der Philosophie, erste Abtheilung. Für seine Zuhörer, 1825.
Im Buchhandel: Göttingen, in Commission der Dieterich'schen
Buchhandlung, 1828 (vgl. Nr. 38). |
|
(16) |
Darstellungen aus der Geschichte der Musik nebst vorbereitenden Lehren, aus der Theorie der Musik. Göttingen, Dieterich'sche Buchhand-lung, 1827. |
|
(17) |
Abriss des Systems der Logik für seine Zuhörer, 1825. Zweite, mit der metaphysischen Grundlegung der Logik und einer dritten Steindrucktafel vermehrte Ausgabe. Ebd., in Commission, 1828. |
|
(18) |
Abriss des Systems der Rechtsphilosophie oder des Naturrechts. Ebd., in Commission, 1828. |
|
(19) |
Vorlesungen über das System der Philosophie. Ebd., in Commission, 1828 (vgl. Nr. 44 und 69). |
|
(20) |
Vorlesungen über die
Grundwahrheiten der Wissenschaft, zugleich in ihrer Beziehung zu dem
Leben. Nebst einer kurzen Darstellung und Würdigung der bisherigen Systeme
der Philosophie, vornehmlich der neuesten von Kant, Fichte, Schelling und
Hegel, und der Lehre Jacobi's. Für Gebildete aus allen Ständen. Ebd. in Commission, 1829 (vgl.
29). |
|
(21) |
(Anonym) Geist der Lehre
Immanuel Swedenborg's. Aus dessen Schriften. Mit einer katechetischen
Übersicht und vollständigem Sach-register. Herausgegeben von Dr. I. M. C.
G. Vorherr. München, E. A. Fleischmann, 1832. |
|
|
|
|
|
|
|
(22) |
Lehre vom Erkennen und von der Erkenntnis, oder Vorlesungen über die analytische Logik und Encyclopädie der Philosophie für den ersten Anfang im philosophischen Denken. Herausgegeben von H. K. von Leonhardi. Mit drei lithograph. Tafeln. 8°. Göttingen, in Commission der Dieterich'schen Buchhandlung, 1836. |
|
(23) |
Vorlesungen über die psychische Anthropologie. Herausgegeben von Dr. H. Ahrens. 8°. Ebd., 1848. |
|
(24) |
Die absolute
Religionsphilosophie im Verhältnis zum gefühlglaubigen Theismus, und nach
einer Vermittelung des Supernaturalismus und des Rationalismus.
Dargestellt in einer philosophisch kritischen Prüfung und Würdigung der
religionsphilosophischen Lehren von Jacobi, Bouterwek und Schleiermacher.
Herausgegeben von H. K. von Leonhardi. Zwei Bände in 3 Abtheilungen. 8°. 1834 – 1843. |
|
(25) |
Novae theoriae linearum curvarum specimina V, ed. H. Schroeder, Professor. (Cum figurarum tabulis XV.) 4°. Ebd., sowie auch in München in Commission bei E. A. Fleischmann, 1835. |
|
(26) |
Abriss der Aesthetik oder der Philosophie des Schönen und der schönen Kunst. Herausgegeben von Dr. J. Leuchtbecher. 8°. Göttingen, in Commission der Dieterich'schen Buchhandlung, 1837. |
|
(27) |
Anfangsgründe der Theorie der Musik, nach den Grundsätzen der Wesenlehre. Vorlesungen für Gebildete aus allen Ständen. Herausge-geben von V. Strauss. 8°. Ebd., 1838. |
|
(28) |
Geist der Geschichte der Menschheit, erster Band; oder: Vorlesungen über die reine d.i. allgemeine Lebenlehre und Philosophie der Geschichte, zur Begründung der Lebenkunstwissenschaft. (Mit einer erläuternden Steindrucktafel und dem Bildnisse des Verfassers.) In einem Bande. Für Gebildete aus allen Ständen. Herausgegeben von H. K. von Leonhardi. 8°. Ebd., 1843. |
|
(29) |
Vorlesungen über die Grundwahrheiten der Wissenschaft, zugleich in ihrer Beziehung zu dem Leben. 1. Band. Auch unter dem Titel: Erneute Vernunftkritik. Zweite, vermehrte Auflage, Prag, F. Tempsky, 1868 (vgl. Nr. 20). |
|
(29a) |
Der zur Gewissheit der Gotteserkenntnis als des höchsten Wissen-schaftsprincipes emporleitende Teil der Philosophie. Zweite, vermehrte Auflage, Prag, F. Tempsky, 1869 (vgl. Nr. 44). |
|
(30) |
Vorlesungen über Rechtsphilosophie. Herausgegeben von K. D. A. Röder. Leipzig, F. A. Brockhaus, 1874. |
| (31) | Vorlesungen über Aesthetik oder die Philosophie des Schönen und der schönen Kunst. Herausgegeben von Dr. Paul Hohlfeld u. Dr. August Wünsche. Weimar, Emil Felber, 1882. |
|
(32) |
System der Aesthetik oder über die Philosophie des Schönen und der schönen Kunst. (Zur Kunstlehre, I. Abtheilung.) Herausgegeben von Dr. Paul Hohlfeld u. Dr. August Wünsche. Weimar, Emil Felber, 1882. |
|
(33) |
Vorlesungen über synthetische Logik nach Principien des Systems der Philosophie des Verf. Herausgegeben von Dr. Paul Hohlfeld u. Dr. August Wünsche. Weimar, Emil Felber, 1884. |
|
(34) |
Einleitung in die Wissenschaftslehre. Herausgegeben von Dr. Paul Hohlfeld u. Dr. August Wünsche. Weimar, Emil Felber, 1884. |
|
(35) |
Vorlesungen über angewandte Philosophie der Geschichte. Herausgegeben von Dr. Paul Hohlfeld u. Dr. August Wünsche. Weimar, Emil Felber, 1885. |
|
(36) |
Der analytisch-inductive Theil des Systems der Philosophie. Herausgegeben von Dr. Paul Hohlfeld u. Dr. August Wünsche. Weimar, Emil Felber, 1885. |
|
(37) |
Reine allgemeine Vernunftwissenschaft oder Vorschule des analytischen Haupttheiles des Wissenschaftgliedbaues. Herausgegeben von Dr. Paul Hohlfeld u. Dr. August Wünsche. Weimar, Emil Felber, 1886. |
|
(38) |
Abriss des Systems der Philosophie. 1. und 2. Abtheilung. (Betreffs der l. Abtheilung vergleiche Nr. 15.) Herausgegeben von Dr. Paul Hohlfeld u. Dr. August Wünsche. Weimar, Emil Felber, 1886. |
|
(39) |
Grundriss der Geschichte der Philosophie. Herausgegeben von Dr. Paul Hohlfeld u. Dr. August Wünsche. Weimar, Emil Felber, 1887. |
|
(40) |
System der Sittenlehre. I. Versuch einer wissenschaftlichen Begründung der Sittenlehre. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage (vgl. Nr. 7). II. Abhandlungen und Einzelgedanken zur Sittenlehre. Herausgegeben von Dr. Paul Hohlfeld u. Dr. August Wünsche. Weimar, Emil Felber, 1888. |
|
(41) |
Zur Geschichte der neueren philosophischen Systeme. Herausgegeben von Dr. Paul Hohlfeld u. Dr. August Wünsche. Weimar, Emil Felber, 1889. |
|
(42) |
Abriss der Philosophie der Geschichte. Herausgegeben von Dr. Paul Hohlfeld u. Dr. August Wünsche. Weimar, Emil Felber, 1889. |
|
(43) |
Philosophische Abhandlungen. Herausgegeben von Dr. Paul Hohlfeld u. Dr. August Wünsche. Weimar, Emil Felber, 1889. |
| (44) | Vorlesungen über das system der Philosophie. 2 Bände. Herausgegeben von Dr. Paul Hohlfeld u. Dr. August Wünsche. Weimar, Emil Felber, 1889. |
|
(45) |
Das Eigenthümliche der Wesenlehre nebst Nachrichten zur Geschichte der Aufnahme derselben, vornehmlich von Seiten deutscher Philosophen. Herausgegeben von Dr. Paul Hohlfeld u. Dr. August Wünsche. Weimar, Emil Felber, 1890. |
|
(46) |
Anschauungen oder Lehren und Entwürfe zur Höherbildung des Menschheitlebens. l. Bd. 1890, 2. Bd. 1891, 3. Bd. 1892, 4. Bd. 1902. Herausgegeben von Dr. Paul Hohlfeld u. Dr. August Wünsche. Weimar, Emil Felber. |
|
(47) |
Anfangsgründe der Erkenntnisslehre. Herausgegeben von Dr. Paul Hohlfeld u. Dr. August Wünsche. Weimar, Emil Felber, l892. |
|
(48) |
Abriss der Geschichte der griechischen Philosophie. Herausgegeben von Dr. Paul Hohlfeld u. Dr. August Wünsche. Weimar, Emil Felber, 1892. |
|
(49) |
Zur Religionsphilosophie und speculativen Theologie. Herausgegeben von Dr. Paul Hohlfeld u. Dr. August Wünsche. Weimar, Emil Felber, 1893. |
|
(50) |
Aphorismen zur Sittenlehre. Herausgegeben von Dr. Paul Hohlfeld u. Dr. August Wünsche. Weimar, Emil Felber, 1893. |
|
(51) |
Der Begriff der Philosophie. Herausgegeben von Dr. Paul Hohlfeld u. Dr. August Wünsche. Weimar, Emil Felber, 1893. |
|
(52) |
Anleitung zur Naturphilosophie. Herausgegeben von Dr. Paul Hohlfeld u. Dr. August Wünsche. Weimar, Emil Felber, 1894. 2., stark vermehrte Auflage (vgl. Nr. 6). |
|
(53) |
Grundlage des Naturrechtes
oder philosophischer Grundrisse des Ideales des Rechtes. Herausgegeben von
Dr. G. Mollat. Weimar, Emil Felber. |
|
(54) |
Erklärende Bemerkungen und Erläuterungen zu J. G. Fichtes Grundlage des Naturrechtes. Herausgegeben von Dr. G. Mollat. Weimar, Emil Felber, 1893. |
|
(55) |
Zur Sprachphilosophie. Herausgegeben von Prof. Dr. theol. et phil. August Wünsche. Weimar, Emil Felber, 1891. |
|
(56) |
Vorlesungen über Naturrecht. Herausgegeben von Prof. Dr. Richard Mucke. Weimar, Emil Felber, 1892. |
|
(57) |
Der Erdrechtsbund an sich selbst und in seinem Verhältnisse zum Ganzen und zu allen Einzeltheilen des Menschheitlebens. Herausgezogen von Dr. G. Mollat. Weimar, Emil Felber, 1893. |
|
(58) |
Abhandlungen und Einzelsätze über Erziehung und Unterricht. I. Band. Herausgegeben von Richard Vetter, Seminaroberlehrer. Weimar, Emil Felber, 1894. |
|
(59) |
Dasselbe, II. Band. Grundlehren der Wissenschaft zum Unterrichte. Herausgegeben von Richard Vetter, Seminaroberlehrer. Weimar, Emil Felber, 1894. |
|
(60) |
Aphorismen zur geschichtswissenschaftlichen Erdkunde. Herausgegeben von Richard Vetter, Seminaroberlehrer. Weimar, Emil Felber, 1894. |
|
(61) |
Zur Theorie der Musik. Herausgegeben von Richard Vetter, Seminar-oberlehrer. Weimar, Emil Felber, 1894. |
|
(62) |
Fragmente und Aphorismen zum analytischen Theile des Systems der Philosophie. Von Karl Christian Friedrich Krause. Aus dem handschriftlichen Nachlasse des Verfassers herausgegeben von Dr. Paul Hohlfeld und Dr. August Wünsche. Weimar, Emil Felber, 1897. |
|
(63) |
Der
Menschheitbund. Nebst Anhang und Nachträgen aus dem
hand-schriftlichen Nachlasse von Karl Chr. Fr. Krause, herausgegeben
von Richard Vetter, Schuldirektor in Dresden-Löbtau. Berlin, Emil Felber,
1900. |
|
(64) |
Sprachwissenschaftliche Abhandlungen von Karl C. F. Krause. Aus dem handschriftlichen Nachlasse des Verfassers herausgegeben von Paul Hohlfeld und August Wünsche. Leipzig, Dieterich, 1901. |
|
(65) |
Lebenlehre oder Philosophie der Geschichte zur Begründung der Lebenskunstwissenschaft. Vorlesungen an der Universität Göttingen gehalten von Karl C. F. Krause. Aufs neue herausgegeben von Paul Hohlfeld und August Wünsche. Zweite Auflage. Leipzig, Dieterich, 1904 (vgl. Nr. 28). |
|
(66) |
Der Briefwechsel K. Chr. Fr. Krause's, herausgegeben von Dr. Paul Hohlfeld und Dr. August Wünsche. Berlin, Emil Felber, 1. Bd. 1903, 2. Bd. 1907. |
|
(67) |
Entwurf eines europäischen
Staatenbundes als Basis des allgemeinen Friedens und als rechtliches
Mittel gegen jeden Angriff wider die innere und äußere Freiheit
Europas (1814). Neu herausgegeben und eingeleitet von Hans Reichel: Die
Philosophische Bibliothek, Band 98. Leipzig, |
|
(68) |
Der Glaube an die Menschheit. Erw. durch ein Lehrfragestück. Hrsg. von Alfred Unger. Zweite und dritte Auflage. Berlin, Unger, 1929. |
|
(69) |
Vorlesungen über das System der Philosophie. Unveränderter Nachdruck der Ausgabe Göttingen 1828 mit einem neuen Vorwort und Anmerkungen. Herausgegeben von Siegfried Pflegerl, 1981. |
|
(70) |
Zur Geschichte der neuen philosophischen Systeme. Neudruck der Ausgabe Leipzig 1889 (vgl. Nr. 41) durch Andras Roser. Passauer Texte zur Philosophie, 1996. |
|
(Ap 73) |
Apel, Karl-Otto: Transformation der Philosophie. Frankfurt am Main 1973. |
|
(Ap 96) |
Apel, Karl-Otto/Kettner, Mattthias (Hg.): Die eine Vernunft und die vielen Rationalitäten. Frankfurt am Main 1996. |
|
(Ar 55) |
Arendt, Hannah: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Frankfurt am Main 1955. |
|
(Au 82) |
Aurobindo, Sri: Das Ideal einer geeinten Menschheit. Gladenbach 1982. |
|
(Au 87) |
Aurobindo, Sri: Die Offenbarung des Supramentalen. Pondicherry 1987. |
|
(Be 02) |
Beck, Ulrich: Macht und Gegenmacht im globalen Zeitalter. Frankfurt am Main 2002. |
|
(Bl 87) |
Bluestone, Natalie Harris: Women and the
ideal society. Oxford, Hamburg, New York 1987. |
|
(Cl 94) |
Claussen, Detlev: Grenzen der Aufklärung. Die gesellschaftliche Genese des modernen Antisemitismus. Frankfurt am Main 1994. |
|
(Da 00) |
Davy, Ulrike: Die
Integration von Einwanderern. Band 1: Rechtliche Regelungen im
Europäischen Vergleich. Europäisches Zentrum für Wohlfahrtspolitik und
Sozialforschung. Wien
2000. |
|
(Da 34) |
D`Alveydre, Saint Ives: L`Archéomètre. Paris 1934. |
|
(Da 99) |
Davidowicz, Klaus S.: Kabbalah. Geheime Traditionen im Judentum. Eisenstadt 1999. |
|
(Di 79) |
Dilacompagne, Christian/Girard, Patrick: Über den Rassismus. Stutt-gart 1979. |
|
(Di 99) |
Dierksmeier, Claus: "Krause und das 'gute' Recht", Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie (Vol. 85, 1999, S. 77). |
|
(Di 03) |
Dierksmeier, Claus: Der
absolute Grund des Rechts. Stuttgart-Bad Cannstatt 2003. |
|
(Do 02) |
Documenta 11_Plattform 5: Ausstellungskatalog. Kassel 2002. |
|
(Dü 02) |
Dürrschmidt, Jörg: Globalisierung. Bielefeld 2002. |
|
(Er 99) |
Erler, Hans/Koschel, Ansger
(Hg.): Der Dialog zwischen Juden und Christen. Frankfurt, New York 1999. |
|
(Fa
99) |
Fassmann,
Heinz/Matuschek, Helga/Menasse, Elisabeth (Hg.): abgren-zen, ausgrenzen,
aufnehmen. Klagenfurt
1999. |
|
(Fe 00) |
Fernandéz, Francisco Querol: La filosofía
del derecho de K. Ch. F. Krause. Madrid 2000. |
|
(Gi 82) |
Gilbert, Martin: Endlösung. Die Vertreibung und Vernichtung der Juden. Ein Atlas. Reinbeck bei Hamburg 1982. |
|
(Gi 89) |
Giese, Cornelia: Gleichheit und Differenz. München 1989. |
|
(Go 98) |
Golomb, Jacob (Hg.): Nietzsche und die jüdische Kultur. Wien 1998. |
|
(Go 02) |
Gosepath, Stefan/Merle, Jean-Christoph (Hg.): Weltrepublik. Globali-sierung und Demokratie. München 2002. |
|
(Gö 31) |
Gölpinarli, Abdülbaki: Melamilik ve Melamiler. Istanbul 1931. |
|
(Ha 81) |
Habermas, Jürgen: Theorie des kommunikativen Handelns. Frankfurt am Main 1981. |
|
(Ha 90) |
Harding, Sandra: Feministische Wissenschaftstheorie. Hamburg 1990. |
|
(He 92) |
Heckmann, Friedrich: Ethnische Minderheiten, Volk und Nation. Soziologie interethnischer Beziehungen. Stuttgart 1992. |
|
(He 02) |
Herz, Dietmar/Jetzlsperger, Christian/Schattenmann, Marc (Hg.): Die Vereinten Nationen. Frankfurt am Main 2002. |
|
(Hö 98) |
Höffe, Otfried: Vernunft und Recht. Bausteine zu einem inter-kulturellen Rechtsdiskurs. Frankfurt am Main 1998. |
|
(Ib 70) |
Ibn`Arabi, Muhji`d-din: Das Buch der Siegelringsteine der Weisheits-sprüche. Graz 1970. |
|
(Jo 98) |
Jochum, Richard: Komplexitätsbewältigungsstrategien in der neueren Philosophie: Michel Serres. Frankfurt am Main 1998. |
|
(Ka 91) |
Kanitschneider, Bernulf: Kosmologie. Geschichte und Systematik in philosophischer Perspektive. Stuttgart 1991. |
|
(Ka 99) |
Karady, Victor: Gewalterfahrung und Utopie. Juden in der euro-päischen Moderne. Frankfurt am Main 1999. |
|
(Ke 98) |
Kershaw, Ian: Der NS-Staat. Geschichtsinterpretationen und Kontro-versen im Überblick. Reinbeck bei Hamburg 1998. |
|
(Kl 99) |
Klotz, Johannes/Wiegel, Gerd (Hg.): Geistige Brandstiftung? Die Walser-Bubis-Debatte. Köln 1999. |
|
(Kn 99) |
Knorr ab Rosenroth: Kabbalah denudata. Englische Übersetzung von S. L. Mac Gregor Mathers 1887. Reprint: Montana, U.S.A. 1999. |
|
(Ko 00) |
Korte, Hermann/Schäfers, Bernhard: Einführung in Hauptbegriffe der Soziologie. Opladen 2000. |
|
(Ko 85) |
Kodalle, Klaus-M. (Hg.): Karl Christian Friedrich Krause (1781-1832). Hamburg 1985. |
|
(Mi 76) |
Mîsrî, Niyâzî: Dîvâni Serhi. Kommentiert durch Seyyid Muhammed Nûr. Istanbul 1976. |
|
(Mi 99) |
Miles, Robert: Rassismus. Einführung in die Geschichte und Theorie eines Begriffs. Hamburg 1999. |
|
(Mu 99) |
Much, Theodor/Pfeifer, Karl: Bruderzwist im Hause Israel. Judentum zwischen Fundamentalismus und Aufklärung. Wien 1999. |
|
(Mü 98) |
Müller, Ernst (Übers.): Der Sohar. Das heilige Buch der Kabbala. München 1998. |
|
(Mün 98) |
Münch, Richard: Globale Dynamik, lokale Lebenswelten. Frankfurt am Main 1998. |
|
(Na 01) |
Nagl-Docekal, Herta: Feministische Philosophie. Frankfurt am Main 2001. |
|
(Or 96) |
Orden Jiménez, Rafael V.: Las habilitaciones
filosóficas de Krause. Madrid 1996. |
|
(Or 98) |
Orden Jiménez, Rafael V.: El sistema de la
filosofía de Krause. Madrid 1998. |
|
(Or 98a) |
Orden Jiménez, Rafael V.: Sanz del Río: Traductor y divulgador de Krause. Madrid 1998. |
|
(Pa 77) |
Papus: Die Kabbala. Schwarzenburg 1977. |
|
(Pf
77) |
Pflegerl,
Siegfried: Gastarbeiter zwischen Integration und Abstoßung. Wien-München
1977. |
|
(Pf
90) |
Pflegerl,
Siegfried: Die Vollendete Kunst. Zur Evolution von Kunst und Kunsttheorie.
Wien-Köln 1990. |
|
(Pf 01) |
Pflegerl, Siegfried: Die Aufklärung der Aufklärer. Frankfurt am Main, Berlin, Wien, New York 2001. ISBN 3-631-36946-8. http://www.peterlang.net/all/index.cfm |
|
(Pf 01a) |
Pflegerl, Siegfried: Ist Antisemitismus heilbar? Frankfurt am Main, Berlin, Wien, New York 2001. ISBN 3-631-37202-7. http://www.peterlang.net/all/index.cfm |
| (Pf 03) | Pflegerl, Siegfried: K. Ch. F. Krauses Urbild der Menschheit. Richtmaß einer universalistischen Globalisierung. Kommentierter Originaltext und aktuelle Weltsystemanalyse. ISBN 3-631-50694-5. http://www.peterlang.net/all/index.cfm |
|
(Po 79) |
Poliakov, Léon: Über den Rassismus. Stuttgart 1979. |
|
(Po 01) |
Polylog, Zeitschrift für interkulturelles Philosophieren: Hybridität. Heft 8/2001. Wien 2001. |
|
(Ra 96) |
Rasuly-Paleczek, Gabriele (Hg.): Turkish Families in Transition. Frankfurt am Main 1996. |
|
(Re 98) |
Reiter, Margit: Das Verhältnis der österreichischen Linken zu Israel im Kontext mit Nationalismus und Antisemitismus. Dissertation Universi-tät Wien 1998. |
|
(Ro 88) |
Rosenzweig, Franz: Der Stern der Erlösung. Frankfurt am Main 1988. |
|
|
|
|
(Sc 57) |
Scholem, Gershom: Die jüdische Mystik in ihren Hauptströmungen. Zürich 1957. |
|
(Si 74) |
Siegfried, Klaus-Jörg: Universalismus und Faschismus. Das Gesell-schaftsmodell Othmar Spanns. Wien 1974. |
|
(Ta 00) |
Taureck, Berhard H. F.: Nietzsche und der Faschismus. Leipzig 2000. |
|
(Tr 00) |
Treibel, Annette: Einführung in soziologische Theorien der Gegenwart. Opladen 2000. |
|
(Ur 01) |
Ureña, Enrique M.:
Philosophie und gesellschaftliche Praxis. Stuttgart-Bad Cannstatt 2001. |
|
(Ur 91) |
Ureña, Enrique M.: K. C. F. Krause.
Stuttgart-Bad
Cannstatt 1991. |
|
(Ur 99) |
Ureña, Enrique M. (Hg.): La actualidad del Krausismo en su contexto Europeo. Madrid 1999. |
|
(Wa 90) |
Waldenfels, Bernhard: Der Stachel des Fremden. Frankfurt am Main 1990. |
|
(Wa 00) |
Waldrauch, Harald: Die Integration von Einwanderern. Band 2. Ein Index legaler Diskriminierung. Europäisches Zentrum für Wohlfahrts-politik und Sozialforschung. Wien 2000. |
|
(We 34) |
Weber, Max: Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. Tübingen 1934. |
|
(We 95) |
Welsch, Wolfgang: Vernunft. Frankfurt am Main 1995. |
|
(We 01) |
Welthaus Bielefeld: Atlas der Weltentwicklungen. Wuppertal 2001. |
|
(We 02) |
Westphal, Christian: Von der Philosophie zur Physik der Raumzeit. Frankfurt am Main 2002. |
| (Wi 04) | Wimmer, Franz Martin: Interkulturelle Philosophie. Eine Einführung. Wien 2004. |
|
(Ze 03) |
Zeilinger, Anton: Einsteins Schleier. Die neue Welt der Quantenphysik. München 2003. |

[1] Das Modell liegt weiterhin im Trend der Systemtheorie. Münch schreibt etwa in (Mün 98): "Die Soziologie hat viele Anläufe zur Beantwortung der Frage nach der Integration moderner Gesellschaften genommen. Sie alle sind weder ausreichend noch wertlos. Es kommt heute darauf an, aus ihnen eine umfassende Theorie aufzubauen. Kein einzelner Theorieansatz kann für sich beanspruchen, umfassend genug konstruiert zu sein, um auf die anderen Ansätze verzichten zu können. Die Soziologie braucht weiterhin alle." Aus den einzelnen Theorien müsste nach Münch ein Theoriennetz geknüpft werden. Das Denken in Netzen ist zeitgemäß, aber selbst eine Folge medial induzierter Bewusstseinsveränderungen, die keineswegs die letzten Bewusstseins-paradigmen sein müssen.
[2] Vgl. etwa Habermas I bei (Tr 00, S. 49 f.).
[3] Vgl. etwa Habermas II bei (Tr 00, S. 155 f.).
[4] Hinsichtlich der neuesten Ansätze zur Analyse der sozialen Stellung der Frau erwähnt (Tr 00) u. a.: Kapitalismus und Patriarchat (Wallerstein, Beer, Bielefelder Ansatz); Mikrotheorie und Geschlechtersoziologie; die Omnirelevanz der Geschlechterkategorisierung (Garfinkel); Symboli-scher Interaktionismus und Ethnomethodologie (Goffman, Garfinkel); Transsexualität und androzentrische Konstruktion der Wirklichkeit (Kessler/McKenna); kulturelle Setzungen: Wie die Geschlechter gemacht und als solche stabilisiert werden (Hagemann-White, Gildemeister); Konstituierung des Geschlechterverhältnisses (Bilden, Hannoveraner Ansatz, Thürmer-Rohr, Hochschild). Für die Elaborierung des Gender-Ansatzes in der feministischen Forschung bietet unser Modell ausreichend viele Elemente und Zusammenhänge.
[5] Vgl. (Tr 00, S. 246 f.).
[6] Eine erkenntnistheoretisch nicht systematisierte Auflistung im dtv-Atlas (1987) zur Psychologie umfasst etwa: Neuropsychologie, Wahrnehmungspsychologie, Gedächtnispsycho-logie, Lernpsychologie, Aktivationspsychologie, Kognitionspsychologie, Emotionspsychologie, Kommunikationspsychologie, Persönlichkeitspsychologie, Entwicklungspsychologie, Sozialpsychologie, Klinische Psychologie mit 20 Schulen (tatsächlich gibt es bereits mehrere hundert), Angewandte Psychologie, Kulturpsychologie.
[7] Wie etwa eine neue politische Kasten- und Rangordnung durch Züchtung einer globalen Herrenkaste bei Nietzsche. Vgl. (Pf 01a, S. 120).
[8] Vgl. vorne das Kapitel: "Gebote der Menschlichkeit – Sittengesetz".
[9] Vgl.
etwa unter http://faculty.washington.edu/modelski/biblio.html.
[10] Eine Kritik des lerntheoretischen Ansatzes bei Habermas siehe in (Pf 90, S. 178 f.)
[11] Die höchste Ableitung der Kategorie "Leben" erfolgt in der Grundwissenschaft (19, S. 480 ff.) und ausführlich in (28).
[13] Vgl. besonders die ausführliche Darstellung in (Pf 01).
[14] Von Krause selbst liegen Ausarbeitungen für die Bildung eines europäischen Staatenbundes vor (67); in Spanien kürzlich untersucht bei (Fe 00, S. 450 ff.).
[15] Andrew Bacevich (Direktor des Center for International Relations) sagt in einem Interview im Standard vom 18. 1. 2003: "Wir haben auch eine bemerkenswerte Fähigkeit, Ideen mit unserem Eigeninteresse zu verknüpfen und sehen darin keinen Widerspruch. Die anderen sehen den sehr wohl. Doch wir können eine imperiale Politik verfolgen und behaupten, sie sei 'gut für die afghanischen Frauen'".
[16] Okwui Enwezor schreibt in: "Die heutige Avantgarde ist so sehr innerhalb der Weltordnung des Empire diszipliniert und domestiziert, dass ganz andere Regulations- und Widerstandsmodelle gefunden werden müssen, um dem Totalisierungsanspruch des Empire entgegenzuwirken. Diesen Widerstand gegen das Empire bezeichnen Hardt und Negri als 'Multitude', als Menge, deren drängende, anarchische Forderungen einem Gegenmodell zum Empire Gestalt geben. Um aber zu begreifen, was dieser Opposition historische Kontinuität verleiht, muss man einmal mehr zur Tendenz der Postkolonialität zurückkehren, neue Modelle von Subjektivität zu definieren. In der Postkolonialität sind wir ständig mit Gegenmodellen konfrontiert, durch die die Marginalisierten – also jene, die von der umfassenden globalen Partizipation praktisch ausgeschlossen sind – neue Welten gestalten, indem sie experimentelle Kulturen hervorbringen. Darunter verstehe ich bestimmte Praktiken, die sich aus Imperialismus und Kolonialismus, Sklaverei und Dienstverpflichtung entstandene Kulturen aneignen, um aus den Fragmenten des kollabierenden Raumes eine Collage von Realität zu schaffen."
[17] In dieser Theorie sind die kolonialen und postkolonialen Subjekte von supplementärer Struktur. Sie genügen sich nicht selbst. Sie bleiben beide partiell und hierarchisch aufeinander verwiesen und erleiden eine Spaltung ihrer Identität. Diese hierarchische gegenseitige Abhängigkeit von Selbst und Anderem wird etwa von Bhabha als Hybridität bezeichnet. Wobei Hybridität nicht nur die Anwesenheit des exotisierten, ethnisierten, diskriminierten Anderen im Selbst und umgekehrt beschreibt, sondern auch den hybriden geografischen, örtlichen Standpunkt von MigrantInnen zwischen Empire und ehemaliger Kolonie, zwischen Exil und Heimat, an jenem dritten Ort des Nicht-Zuhause zuhause. Vgl. auch (Po 01).
[18] Folgende
evolutionslogische Überlegung sei hier angebracht. Das "moderne westliche"
Staatsmodell basiert auf dem abstrakten Begriff des individualisierten
Bürgers, dessen Rechte zum Staat unmittelbar aus der abstrakten
Rechtsordnung fließen, ohne dass auf die Zugehörigkeit des Subjektes zu Familie
und Verwandtschaft Bezug genommen wird. Dies ist auch ein Grund, weshalb die
postkoloniale Theorie den aus der Aufklärung stammenden Begriff des autonomen
Individualismus und die in ihm angelegte Universalisierung ablehnt. Im
Weltstaat des III. HLA und seinen inneren Rechten werden neue, ebenfalls
abstrakte, in den derzeitigen Sinn- und Begriffshorizonten überhaupt nicht
sichtbare Rechtsprinzipien Eingang in die menschliche Gesellschaftlichkeit
aller Systemtypen finden. Darin wird die Position des Bürgers und das
Verhältnis aller Bürger im Weltstaat untereinander neu geregelt. Hierbei erfährt
natürlich die Theorie des autonomen Subjektes eine deutliche Veränderung und
Vertiefung. Diese Perspektive relativiert die Entwicklungs- und
Modernisierungsideologien des Westens beträchtlich. Denn das westliche Modell
ist auch nur ein Übergangsmodell mit Mängeln, da es aufgrund seiner
mangelnden Entwicklung Verzerrungen besitzt. Der Weg geht daher vom isolierten
autonomen Subjekt zum (Or-Om)-Subjekt, das eine neue psychische Struktur
besitzt. Dieses ist sich seiner Verbindung mit anderen Subjekten anders bewusst
und die Rechtsordnung berücksichtigt die neuen Strukturen bereits in der
Verfassung.
[19] Vgl. hierzu besonders (Pf 77, S. 23 f.).
[20]
Hinsichtlich der Sprachen der Welt vgl. etwa http://www.ethnologue.com/country_index.asp.
[21] Eine gute Einführung bietet Heinz Kimmerle: Interkulturelle Philosophie zur Einführung unter:
http://home.concepts-ict.nl/~kimmerle/Phil.Einf2.htm. Die interkulturelle Philosophie wird weiter unten genauer behandelt.
[22] Das
Verschwinden religiöser Fundierung in einer Weltgesellschaft ist eher nicht
anzunehmen. Wir gehen vielmehr davon aus, dass sich die Vielfalt der derzeitigen
Formen religiös-metaphysischen Lebensbezuges nach schwersten politischen Krisen
und Kämpfen in die Religiosität des Erwachsenenalters weiterbilden wird, die als
die eine Religion der Menschheit in der göttlichen Vernunft begründet
ist.
[23] Gegenteilige Interpretationen Dierksmeiers in (Di 03, S. 508 f.) erscheinen problematisch.
[24] Hier muss auch erwähnt werden, dass Krause selbst nachträglich erkannte, dass er bestimmte Ereignisse und Entwicklungen seiner Zeit im Sinne seiner Ideen falsch beurteilte. So schätzte er in einer frühen Schrift über einen Weltstaat den evolutiven Charakter Napoleons für eine Integration Europas hoch ein, musste aber später erkennen, dass er sich diesbezüglich getäuscht hatte. Derartige Fehlbeurteilungen geschichtlicher Zustände ändern aber nichts an der Bedeutung der sozialen Ideen, die in der Grundwissenschaft entwickelt werden. Denn diese Ideen bestehen, ähnlich mathematischen Regeln, unabhängig von den geschichtlichen Gegebenheiten und der individuellen Beurteilung derselben.
[25] Wenn auch eine Monopolisierung in den Händen weniger Konzerne und die geringe Verbreitung in den Peripherien offensichtlich sind.
[26] Weitere Zitate aus (30) zur Frage der sozialer Gleichheit, persönlicher Freiheit und den Wirtschaftsgesetzen enthält (Pf 01, S. 241 f.).
[27] Zur Frage des Weltstaates, Erdrechtsbundes vgl. auch (Di 03, S. 516 f.).
[28] In "Konstruktionen transnationaler Gerechtigkeit" (Go 02, S. 181 ff.).
[29] Wir zeigten oben, dass in vielen Teilen der Erde sich Staaten erst mühsam bilden und die Bildung mancher Staaten dringend zu erwarten ist (Kurden, Palästinenser, Roma). Die Idee der Eliminierung der Nationalstaatlichkeit überhaupt erweist sich angesichts dieser Gegebenheiten als evolutionslogisch äußerst problematisch.
[30] Einen
guten Überblick bietet http://home.concepts-ict.nl/~kimmerle/Phil.Einf2.htm.
[31] Vgl. hierzu unsere Ausführungen zur Universalsprache, die sich aus der Grundwissenschaft ergibt.
[32] Wir haben vorne deren völlig andere psychologische und soziale Eigentümlichkeiten hervorgehoben.
[33] Fußnote Pflegerl: Die oben erwähnte Vielfalt der Vernunftkonzepte zeigt dies deutlich.
[34] Fußnote Pflegerl: Damit wendet sich Mall etwa gegen die eher formal orientierte Administrationsvernunft bei Welsch.
[35] Wie steht es nun mit der
selbstreferentiellen Konsistenz unserer eigenen Sätze bezogen auf das vorgelegte
neue Vernunftkonzept?
Alle Sätze dieser Arbeit
gehören dem System der All-Sprache der Grundwissenschaft an, dessen Semantik
durch die Erkenntnisse der Grundwissenschaft, dessen Syntax durch die
All-Gliederung der Wesenheiten und Wesen an und in dem unendlichen und
unbedingten Grundwesen und dessen Pragmatik durch die Endschau der Entwicklung
der Menschheit nach der Lebenslehre der Grundwissenschaft bestimmt wird.
Diese Sätze sind so weit
systeminvariant gegenüber allen bisherigen Kultur- und Sozialsystemen, dass sie
in der Lage sind, Grundlage einer wissenschaftlichen, universellen Rationalität
darzustellen, die ihrerseits universelle Prinzipien für Wissenschaft, Kunst und
Sozialität im planetaren Sinne bilden kann.
Es kann hier der Einwand
vorgebracht werden, das hier als neu festgestellte Grundsystem sei ja nur in
unserer üblichen Sprache beschreibbar, setze also eine grüne Systemsprache,
unsere Umgangssprache, voraus (pragmatisch-linguistisches Argument), diese Sätze
müssten verstanden werden und setzen bereits wieder ein sozial vorgeformtes
Sprachverständnis voraus (hermeneutischer Aspekt), kurz, die
konsensual-kommunikative Rationalität Apels oder eine andere an der formalen
Logik festegemachte Rationalität sei unhintergehbare Bedingung dieser Sätze.
Dazu ist zu sagen: Diese Zeilen in einer grünen Systemsprache, einer
systemmitbedingten Sprache abgefasst, sind Anleitung und Hinweis, bestimmte
bereits nicht mehr der Sprache der jeweiligen Gesellschaft angehörende
Erkenntnisse, Gedanken, anzuregen. Diese Sätze sind aber für die Erkenntnisse
der Grundwissenschaft nicht konstitutiv und sie bedürfen auch zu ihrer
Begründung nicht eines kommunikativen oder gar interkulturellen Konsenses. Wohl
aber ist zur Einführung dieser Erkenntnisse erforderlich, dass es gelingt, sie
in der Kommunikations-gemeinschaft aller Menschen über kommunikativ-konsensuale
Prozesse bekannt zu machen und die Gesellschaften nach ihren universalen
Prinzipien weiterzubilden.